Wissenschaftliche Dokumentation der Recherche über
Die Geschichte der Alten Synagoge Freiburg aus eigentumsrechtlicher Perspektive
vorgelegt am 31.05.2019
überarbeitete Fassung, vorgelegt am 08.10.2019; aktualisiert Oktober 2020
von Julia Wolrab M.A.
1. Einleitung
„Wenn wir über das Vergangene berichten, ist die Zukunft sicher: wenn wir die Vergangenheit verleugnen, ist die Zukunft in Gefahr.“ (Elie Wiesel) [1]
Als Überlebender des Holocaust setzte sich der jüdische Schriftsteller Elie Wiesel Zeit seines Lebens für die Erinnerung und die Aufarbeitung der Geschehnisse ein, die er als 17-Jähriger u.a. im KZ Buchenwald selbst miterleben musste. Für seinen unermüdlichen Einsatz im Kampf gegen das Vergessen wurde Wiesel 1986 der Friedensnobelpreis verliehen. Sehr deutlich hat er im eingangs angeführten Zitat den Zusammenhang zwischen Vergangenem und Zukünftigem erfasst. Dieses Zitat steht damit nahezu exemplarisch für einen Auftrag der Geschichtswissenschaft, der stets auch eine politische Konnotation besitzt: Vergangenes sichtbar zu machen, um gewesene soziale Prozesse und Entwicklungen zu verstehen und daraus Schlüsse für gesellschaftliches wie individuelles menschliches Handeln in Gegenwart und Zukunft ziehen zu können. Dieses Anliegen sei auch der hier vorgelegten wissenschaftlichen Dokumentation zugrunde gelegt.
Der Platz der Alten Synagoge in Freiburg bietet ein Fenster in eines der dunkelsten und gleichzeitig am wenigsten erforschten Kapitel der knapp 900-jährigen Stadtgeschichte. Dieser Platz, der heute im Zentrum der Stadt liegt, vereint Aspekte aus Politik, Religion, Kultur, Begegnung, Repräsentanz, Abschottung, Öffnung und Zerstörung wie kaum ein anderer öffentlicher Platz in Freiburg: Bis ins 19. Jahrhundert hinein am Rande der Altstadt und außerhalb des eigentlichen Zentrums gelegen, wuchs seine Bedeutung mit der Errichtung des Freiburger Bahnhofs sowie späterer Prachtbauten rasch an. Das religiöse Zentrum des Platzes bildete ab 1870 die Synagoge [2] der Stadt Freiburg. Der 1926 nach dem Gründer der Caritas, Lorenz Werthmann, benannte Platz zog aufgrund seiner attraktiven Lage bald Begehrlichkeiten aus städtischer und unternehmerischer Seite auf sich. Als die Synagoge 1910 erweitert werden sollte, gab es erhebliche Bedenken hinsichtlich dieses Vorhabens, war doch die Verbreiterung der Straßenführung das eigentliche Ziel der Stadt. Diese, noch überwiegend pragmatischen Überlegungen wichen ab 1933 dem gezielten Wunsch der Nationalsozialisten, jüdisches Leben aus der Stadt zu verbannen und mit gezielten Aktionen gewaltsam gegen Jüdinnen und Juden in Freiburg vorzugehen. [3] Einen Höhepunkt dieser Ausschreitungen bildete im November 1938 die Zerstörung der Freiburger Synagoge, gefolgt von massenhaften Verhaftungen und Deportationen der Freiburger Juden.
Das Areal, auf dem die 1938 zerstörte Synagoge stand, wurde 1939 schließlich unter Zwang vom Oberrat der Israeliten Badens an die Stadt Freiburg verkauft. [4] Die Umstände dieses Verkaufs sind bislang kaum erforscht. Auch ein systematischer Überblick über den Verlauf der Maßnahmen, die im Zuge von Restitution und „Wiedergutmachung“ [5] nach 1945 stattgefunden haben, liegt bislang nicht vor. Ziel der vorliegenden, von der Stadt Freiburg beauftragten Arbeit ist deshalb die Recherche und Dokumentation dieser Vorgänge, ebenso wie die grundsätzliche Nachzeichnung der Geschichte der Alten Synagoge Freiburg. Ein besonderes Augenmerk soll dabei auf eigentumsrechtliche Aspekte sowie den Verbleib der Kaufsumme von 1939 gelegt werden.
Dabei kann sich diese Arbeit auf nur wenige lokalgeschichtliche Vorarbeiten stützen.
Andrea Brucher-Lembach hat in ihrer 2004 publizierten Dissertation dargelegt, wie die „Arisierung“ [6] und der Versuch der „Wiedergutmachung“ nach 1945 aus lokalhistorischer Perspektive in Freiburg vonstattenging und wie beide Vorgänge aus heutiger Sicht zu beurteilen sind. Sie arbeitete dafür mit Zeugnissen und Überlieferungen von Freiburger Jüdinnen und Juden und verlieh ihnen auf diese Weise eine neue Stimme. [7] Die Geschichte der Freiburger Synagoge spielt dabei jedoch keine wesentliche Rolle. Eine wissenschaftliche Betrachtung, die sich der Geschichte der zerstörten Freiburger Synagoge als zentralem Thema und somit auch dem religiösen und kulturellen Erbe der Israelitischen Gemeinde KdöR [8] nähert, ist bislang nicht erarbeitet worden.
Gerade vor dem Hintergrund der in Freiburg jüngst auf vielen Ebenen diskutierten städtischen Erinnerungskultur und des Umgangs der Öffentlichkeit mit dem Platz der Alten Synagoge heute gewinnt diese Geschichte eine neue, für die Gegenwart nicht zu unterschätzende Bedeutung. Die Stadt Freiburg möchte auf diese Leerstelle reagieren und hat zu diesem Zweck diese Arbeit in Auftrag gegeben.
Problemstellung und Zielsetzung
Es ist nicht zuletzt den bislang noch nicht oder nicht hinreichend ausgewerteten Quellen geschuldet, dass die Geschichte der Freiburger Synagoge und des Areals, auf dem sie einst stand, heute noch als weitgehend unerforscht gilt. In Städten wie Berlin oder Darmstadt konnten bereits Untersuchungen angestellt werden, die Einblick in die jüngere Geschichte der zerstörten jüdischen Gotteshäuser geben und damit auch eine historiographische Grundlage für das heutige Zusammenleben liefern. [9] Die Geschichte der Freiburger Synagoge wird zwar am Rande einiger Darstellungen zur Geschichte der Freiburger Juden oder des Nationalsozialismus thematisiert. Eine Arbeit, die sich sowohl ihrer Entstehung und Bedeutung als auch dem Verlust, der Zerstörung und der Restitution widmet, wurde bislang jedoch nicht vorgelegt. Dementsprechend ergeben sich eine ganze Reihe wissenschaftlich relevanter Fragen, deren Betrachtung sich gewiss nicht auf das hier beschriebene Forschungsvorhaben beschränken lässt. Die zu erarbeitende Dokumentation fokussiert deshalb, dem Wunsch der Stadt Freiburg entsprechend, auf die bislang nicht hinreichend bekannten Besitzverhältnisse, den erzwungenen Verkauf des Synagogenareals sowie den Vorgang der Restitution rund um das Jahr 1948.
Vergleichbar kurze, wissenschaftliche Annäherungen an die Geschichte der Alten Synagoge Freiburg, beispielsweise in Form von einzelnen Kapiteln, wurden bislang vor allem von Gabriele Blod, Andrea Brucher-Lembach sowie von Kathrin Clausing vorgenommen. Blod skizziert die Zusammenhänge rund um den Bau der Freiburger Synagoge 1869/70 und bettet ihn in die Entstehung der Israelitischen Gemeinde Freiburg von 1849 bis 1871 ein. [10] Andrea Brucher-Lembach beschreibt die Vorgänge rund um die Pogromnacht und die Zerstörung der Synagoge. Sie verweist darin auf die weitere Verwendung des Areals der Synagoge, das am 15. März 1939 an die Stadt Freiburg verkauft wurde „für die Errichtung eines Parkplatzes“ sowie auf Verhandlungen, die das städtische Liegenschaftsamt schon im Vorfeld mit der Jüdischen Gemeinde geführt hat. [11] Die jüngste Betrachtung einer Teilgeschichte der Synagoge hat Kathrin Clausing im Rahmen ihrer Überblicksdarstellung zur Geschichte der Freiburger Juden im Nationalsozialismus aus einer möglichst alle Lebensbereiche integrierenden Perspektive vorgenommen. Darin legt sie mitunter dar, dass die Stadt auf das Areal, auf dem die Synagoge bis 1938 stand, bereits vor dem 1939 erfolgten Verkauf spekuliert hat und sich mit dem letztlichen Erwerb nach der Reichspogromnacht ein für die Stadt langgehegter Wunsch erfüllte. [12]
Aus den Akten des Stadtarchivs geht indes hervor, dass die Kaufsumme über 67.000 RM, abzüglich 5.602 RM für den Abbruch der Überreste der Synagoge, von der Stadt Freiburg auf ein Sperrkonto bei der Deutschen Bank eingezahlt wurde. [13] Aus den städtischen Akten kann ferner rekonstruiert werden, dass die Einzahlung der Summe auf ein Sperrkonto auch von der Israelitischen Gemeinde bestätigt wurde. [14] Der weitere Verbleib von Kaufsumme und Sperrkonto bei der Deutschen Bank gelten heute jedoch als ungewiss. Eine Recherche der Badischen Zeitung im Juli 2018 hat ergeben, dass das Zentralarchiv der Deutschen Bank keinerlei Akten oder Kontounterlagen über diesen Vorgang mehr besitzt. [15]
Vor diesem Hintergrund ergeben sich folgende, für die Recherche und Analyse relevante Fragen, deren Bearbeitung und Annäherung Gegenstand des in Auftrag gegebenen Werkes sein sollen.
Die Phase der „Arisierung“ ab 1933 betreffend:
- Wann und unter welchen Umständen entstand der Wunsch der Stadt, das Areal der Israelitischen Gemeinde zu erwerben bzw. für sich nutzbar zu machen?
- Welchen Einfluss hatten die städtebaulichen Pläne der Stadt auf den erzwungenen Verkauf des Areals?
- Welche Behörden waren an diesem Verkauf und der im Vorfeld geführten Verhandlungen beteiligt? Wie sind diese im Einzelnen vorgegangen?
- Wie ist der Verkauf des Synagogenareals vor dem Hintergrund weiterer Arisierungsvorgänge in Freiburg und Baden einzuschätzen?
- Was ist mit der eingezahlten Kaufsumme und dem in den Akten erwähnten Sperrkonto geschehen?
Die Phase der Restitution betreffend:
- Wie verlief die Restitution hinsichtlich des Synagogenareals im Einzelnen?
- Auf welcher Grundlage erfolgte der Vergleich, der zwischen der Stadt Freiburg und der Israelitischen Landesgemeinde am 26. November 1948 geschlossen wurde?
- Wie ist der Vorgang der Restitution hinsichtlich des 1939 erfolgten Verkaufs „unter Zwang“ aus Sicht der vorhandenen Quellen zu beurteilen?
- Wer ist Rechtsnachfolger der damaligen Eigentümer geworden?
Das Erkenntnisinteresse dieser Forschungsarbeit besteht demnach zunächst aus der Klärung der eigentumsrechtlichen Verhältnisse des Areals der Alten Synagoge Freiburg von 1933 bis heute sowie den Umständen, die aus historiographischer Perspektive dazu geführt haben. In diesem Zusammenhang soll anschließend herausgearbeitet werden, unter welchen Umständen das Areal 1939 an die Stadt Freiburg verkauft wurde und wo die im Kaufvertrag vom 15. März 1939 angegebene Summe verblieb, die auf ein Sperrkonto eingezahlt werden sollte. Ferner gilt es, die einzelnen Schritte der Restitution zu dokumentieren. Diese Vorgänge sollen schließlich in den breiteren Kontext von „Arisierung“ und Restitution in Deutschland bzw. Baden eingebettet werden und die gegenwärtige Situation in Freiburg mitberücksichtigen.
Stand der Forschung
Historiographische Arbeiten zur Geschichte und den Schicksalen neuzeitlicher Synagogen in Deutschland bilden derzeit erstaunlicherweise noch ein Forschungsdesiderat. Zwar liegen einzelne Arbeiten zu jüdischen Gotteshäusern vor, die eine kunst- oder baugeschichtliche Perspektive einschließen. Forschungen, die sowohl auf die individuelle kulturelle Bedeutung, die Zerstörungen 1938 sowie die teilweise erfolgte Restitution nach 1945 Bezug nehmen, sind bislang jedoch ein weitgehendes Manko in der Geschichtswissenschaft. [16]
Die Alte Synagoge Freiburg findet bislang leidglich in einigen wenigen lokalgeschichtlichen Arbeiten Beachtung, darunter die bereits erwähnten Untersuchungen von Blod, Brucher-Lembach und Clausing. [17] Es lohnt daher ein Blick in vergleichbare lokalgeschichtliche Studien, deren thematische Fragestellung sich ebenfalls mit dem Prozess der „Arisisierung“ und bzw. oder dem der Restitution befassen. Ein Beispiel, das an dieser Stelle besonders herausgestellt werden soll, ist die Arbeit von Claudia Flümann zu „Arisierung“, Enteignung und Wiedergutmachung in Krefeld. [18] Aufgrund der teils desolaten Quellenlage ergibt sich für sie fast zwangsläufig die Vorgehensweise, „Arisierung“ und Restitution als zusammenhängende Prozesse zu betrachten. Akten über den Prozess der Rückerstattung könnten, so Flümann, in vielen Fällen als „Ersatzüberlieferung“ auch Auskunft über den nicht mehr rekonstruierbaren Prozess der „Arisierung“ geben. [19] Diese kombinierte Herangehensweise soll auch methodische Grundlage des hier beschriebenen Vorhabens sein. [20]
Grundsätzlich gilt das Forschungsfeld der „Arisierung“ heute aber als relativ gut untersucht und dokumentiert. [21] Bis in die 1990er Jahre hinein waren Arbeiten dazu noch die Ausnahme, was mitunter an den nur schrittweise aufgehobenen Sperrfristen lag, die eine Sichtung der vorhandenen Quellen erst zu diesem späten Zeitpunkt ermöglichten. Erste wegweisende Arbeiten auf lokalhistorischer Ebene wurden schließlich von Frank Bajohr angeführt. Es folgten weitere Untersuchungen, die ebenfalls lokale Strukturen und Begebenheiten in den Blick nahmen. [22]
Die „Wiedergutmachung“, die mit den Prozessen von „Arisierung“ und Restitution eng verbunden ist, wurde in jüngerer Zeit maßgeblich von Constantin Goschler und Hans Günter Hockerts untersucht und aufgearbeitet. [23] Goschler konnte sich für seine Forschungen auf die frühen Vorarbeiten von Walter Schwarz [24] oder Christian Pross [25] stützen, die er aufgrund ihres „moralisierenden Tonfalls“ (Pross) oder ihrer Monoperspektivität auf die Sicht der Akteure (Schwarz) teilweise kritisierte und alternative Interpretationen anbot. [26] Hockerts war es schließlich auch, der gemeinsam mit Christiane Kuller und weiteren Autoren die öffentliche Verwaltung sowie die NS-Finanzpolitik untersucht hat. [27] Ihre Arbeiten haben in dem hier umschriebenen Vorhaben auch deshalb eine Bedeutung, da die Finanzpolitik des NS-Staates den Weg für die sukzessive Entrechtung und Enteignung der Juden in besonderem Maße bereitete. [28]
Für den Rechercheprozess ebenso relevant war die Frage nach der Rolle der Deutschen Bank bei den Vorgängen rund um die Verwaltung des Sperrkontos, auf das die Kaufsumme durch die Stadt Freiburg eingezahlt wurde. Inwiefern arbeitete die Bank mit den lokalen Behörden zusammen? Welche möglichen Wege hat die Kaufsumme genommen und wen begünstigten diese Vorgänge? Eine Annäherung an diese Fragen bietet die Arbeit von Harold James, der sich intensiv mit der Deutschen Bank und dem Prozess der „Arisierung“ auseinandergesetzt hat. [29] Einen weiteren, für diese Untersuchung nicht zu vernachlässigenden Aspekt bilden schließlich auch die Ambitionen der lokalen NS-Baubehörden rund um den Generalbebauungsplan für die Stadt Freiburg, die erst kürzlich von Heinrich Schwendemann zusammengefasst wurden. [30] Dass die dort erkennbaren Motive der städtischen Behörden für den erzwungenen Ankauf des Synagogenareals noch deutlicher zutage treten mögen, war eine Hoffnung, die an die Sichtung und Analyse des vorhandenen bzw. noch auszumachenden Quellenmaterials geknüpft ist.
Quellenlage
Eine umfassendere historiographische Untersuchung und Darstellung der Geschichte der Freiburger Synagoge wurde bislang nicht vorgenommen. Die hier skizzierte Auftragsforschung verfolgt den Anspruch, vorhandenes, jedoch bislang nicht berücksichtigtes Aktenmaterial zu erschließen und auszuwerten sowie bereits bekannte Akten erneut zu sichten und zur Beantwortung der oben beschriebenen Fragenkomplexe heranzuziehen.
Hierzu kann zum einen auf die Bestände des Freiburger Stadtarchivs zurückgegriffen werden. Dort befinden sich mitunter die Akten, die den Kauf des Grundstücks 1868/69, den Bau der Synagoge sowie ihre Erweiterung dokumentieren. Ferner ist der innerstädtische Schriftverkehr zwischen dem Liegenschaftsamt und der Oberfinanzdirektion in Karlsruhe erhalten, der den Verkauf des Synagogenareals an die Stadt Freiburg dokumentiert. [31] Das Restitutionsverfahren von 1948 kann ebenfalls über die im Stadtarchiv befindlichen Akten, zumindest in Teilen, rekonstruiert werden. [32] Dazu zählen auch die Vorgänge hinsichtlich der Einfriedung des jüdischen Friedhofs und der Erbauung eines Wärter- und Leichenhauses: Verpflichtungen, die die Stadt Freiburg als Gegenleistung für den Erhalt der Grundstücke Werthmannplatz 1 und 3 im Vergleich von 1948 eingegangen ist. [33]
Im Staatsarchiv Freiburg, der Abteilung des baden-württembergischen Landesarchivs, die für den Regierungsbezirk Freiburg zuständig ist, befindet sich indes eine große Anzahl an Akten aus der Zeit der Restitution nach 1945. [34] Bei einer Recherche nach Unterlagen zum Bereich „Vermögenskontrolle/Wiedergutmachung“ im Zusammenhang mit der Synagoge in Freiburg konnte eine Akte in Form einer Sammelkarte ermittelt werden, die wichtige Rückschlüsse auf die Vorgänge der Restitution zulässt. [35] Im Generallandesarchiv in Karlsruhe (GLA), in dem das Schriftgut der Landesbehörden und Gerichte im Regierungsbezirk Karlsruhe sowie der dort angesiedelten regionalen Bundesbehörden aufbewahrt werden, konnten nach einer schriftlichen Anfrage vom 14.02.2019 mit anschließender Korrespondenz keine für die hier behandelte Fragestellung relevanten Akten aufgefunden werden. Eine Ausnahme bildet die Akte des Badischen Finanzministeriums in GLA 237, Zugang 1967-19, Nr. 2106, bezüglich der Vormerkung von Grundstücken in Freiburg, an welchen ein städtebauliches Interesse bestand. Dazu zählte auch das Flurstück der Synagoge am Werthmannplatz. [36] Die eigentumsrechtlichen Verhältnisse am Platz der Alten Synagoge nach 1948 lassen sich wiederum über die Registratur des Liegenschaftsamts Freiburg, welche die Autorin im Rahmen ihrer Recherchen einsehen durfte, nachzeichnen. [37]
Ein wichtiges Komplement zu den städtischen und staatlichen Akten bilden die Aufzeichnungen und Überlieferungen aus der Israelitischen Gemeinde Freiburg selbst. Insgesamt sechs Filmrollen Mikrofilm (Duplikate aus dem Holocaust Memorial Museum in Washington) mit nahezu 2.800 bislang nicht ausgewerteten Dokumenten, befinden sich in der Israelitischen Gemeinde Freiburg. Sie beinhalten zum einen den Schriftverkehr von Freiburger Mitgliedern der Israelitischen Gemeinde, vor allem der jeweiligen Vorsitzenden bzw. des Oberrats mit der Stadt Freiburg sowie mit weiteren deutschen kommunalen und Landesbehörden vor und nach 1945, aber auch Korrespondenzen zwischen einzelnen, oftmals ehemaligen Mitgliedern. Die Themen der Schriftwechsel beziehen sich u.a. auf die Themen „Rückwanderung 1945-48“, „Finanzen der Gemeinde 1927-1938“, „Korrespondenz mit der Gestapo und der Polizei über das Haus ‚Rotteckstr. 6, Beschlagnahmung’“ oder „Schriftwechsel S-Z, 1949-1950, Arisierungsbeschreibungen, Berichte über Deportationen“. Die Filme bzw. Abschnitte, die einen thematischen Bezug zu den oben aufgeworfenen Fragestellungen besitzen, wurden im Rahmen der Forschungsarbeit gesichtet und ausgewertet.
Als besonders ergiebig und hilfreich hat sich die Recherche im Zentralarchiv zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland in Heidelberg herausgestellt. Die dort aufbewahrten Korrespondenzen aus der Israelitischen Gemeinde Freiburg KdöR von 1940 bis in die 1970er Jahre hinein, die sich teilweise mit den Mikrofilmbeständen aus dem Holocaust Memorial Museum decken, ebenso wie die Akten aus der Korrespondenz von Karl Eisemann, dem Leiter der badischen Zweigstelle der „Reichsvereinigung der Juden“, die sich ebenfalls im Zentralarchiv befinden, bildeten das zentrale Quellenmaterial für die hier vorgelegte Arbeit. [38]
Informationen über den Verbleib des Sperrkontos, auf das die Kaufsumme 1939 von der Stadt Freiburg vermutlich eingezahlt worden ist, konnten mitunter im Archiv der Deutschen Bank in Frankfurt/Main eingeholt werden. [39]
Weitere Anfragen wurden an das Landesarchiv Berlin (Schreiben vom 1.12.2018) sowie an das Sonderarchiv in Moskau (Schreiben vom 29.1.2019) gerichtet. Das Landesarchiv Berlin beherbergt neben den Unterlagen des Bundesamts zur Regelung offener Vermögensfragen die Akten des ehemaligen Finanzamts Berlin Moabit-West. Die Moabiter Akten sind deshalb von besonderem Interesse, da sie die Vermögenslisten emigrierter Juden enthalten, auf deren Grundlage die Enteignung der jüdischen Bevölkerung mit erschreckender Akribie erfolgte. [40] Der Bestand des Sonderarchivs in Moskau, das 1945 als Aufbewahrungsort für nicht-russische, vor allem deutschsprachige historische Dokumente gegründet wurde, umfasst eine große Anzahl an Überlieferungen aus staatlichen Behörden und Institutionen der Reichs-, Länder-, und kommunalen Ebene sowie vereinzelt Bestände aus den während der NS-Zeit verfolgten Organisationen, so auch jüdischer Organisationen, insbesondere im Zeitraum zwischen 1918 und 1945. Die dortigen Bestände gelten als weitgehend unerforscht. Die Auskünfte und Recherchen der Mitarbeiter, sowohl in Berlin als auch in Moskau haben jedoch keine neuen Erkenntnisse oder relevante Spuren für die Rekonstruktion der Geschichte der Alten Synagoge und den angrenzenden, hier zu behandelnden Themengebieten erbracht. [41]
Methodisches Vorgehen
Wie bereits an obiger Stelle erwähnt, sieht das hier zu besprechende Forschungsvorhaben eine kombinierende Betrachtung von „Arisierungs“- und Restitutionsvorgängen am Beispiel des Areals der Alten Synagoge in Freiburg vor.
Dafür wurde in einem ersten Schritt der umfangreiche Bestand an Sekundärliteratur, der hier nur in Teilen abgebildet werden kann, herangezogen, um die Geschichte des Synagogenareals in einen größeren historischen Zusammenhang einzubetten. Hierbei wurden insbesondere folgende zentralen Ereignisse und Entwicklungen berücksichtigt: Entstehung der jüdischen Gemeinde in Freiburg, Bau der Synagoge 1869/70, antisemitische Agitationen in Teilen der Bevölkerung vor 1933, sukzessive Entrechtung der Juden auf Reichs- und Stadtebene nach 1933, Zerstörung der Synagoge 1938 sowie die sich anschließende Steigerung hinsichtlich Entrechtung, Ausplünderung und Vertreibung bis hin zur Ermordung der jüdischen Bevölkerung. Nach 1945 spielten die Beginne der „Wiedergutmachung“, die Rückwanderung von Gemeindemitgliedern und der Umgang der Stadt mit dem Platz der Alten Synagoge eine besondere Rolle.
In einem zweiten Schritt wurden bereits veröffentlichte oder zumindest in Teilen bekannte Archivalien gesichtet und analysiert. Im Rahmen der Recherche haben sich auch eine Vielzahl von neuen, bislang kaum besprochenen Quellen, vor allem aus dem Zentralarchiv in Heidelberg, aufgetan, die es ermöglichen, neue Erkenntnisse und Zusammenhänge bei der Rekonstruktion der Geschichte der Alten Synagoge sowie des Verbleibs der Kaufsumme für das Synagogengrundstück aufzuzeigen. Auch diese Quellen konnten gesichtet, ausgewertet und in die vorliegende Dokumentation integriert werden.
Der Aufbau der schriftlichen Dokumentation folgt einem chronologischen Schema von den Anfängen jüdischen Lebens in Freiburg im 13. Jahrhundert bis in die Gegenwart im Jahr 2019. Dies erscheint sinnvoll, auch um einer möglichst breiten Zielgruppe Orientierung und einen niedrigschwelligen Zugang zu diesem Thema zu ermöglichen. Zur Illustration sollen Fotoaufnahmen in die Verschriftlichung mit einfließen. [42] Die eigentumsrechtlichen Verhältnisse am Platz der Alten Synagoge zwischen 1868 und 1978 werden mithilfe einer ergänzenden Skizze verdeutlicht. [43]
Der gesamte hier beschriebene Themenkomplex beinhaltet ein erhebliches Potential für Begriffskontroversen. So sind „Arisierung“, „Wiedergutmachung“ aber auch „Rückerstattung“ Ausdrücke, die in der Forschung zwar bis heute weiter reproduziert werden, allerdings kaum hinsichtlich möglicher Alternativen diskutiert wurden. Am Rande der vorzunehmenden Recherchearbeit soll deshalb der Versuch unternommen werden, die Begrifflichkeiten in ihrer Ambivalenz zu beschrieben und sie damit einer kritischen Reflexion zu unterziehen.
Am Ende der Dokumentation werden die wichtigsten Ergebnisse der Recherche schließlich noch einmal zusammengefasst, Leerstellen benannt und Perspektiven für die Weiterarbeit an offen gebliebene Fragen aufgezeigt.
2. Eine Gemeinde entsteht, eine Synagoge wird gebaut – Jüdisches Leben in Freiburg bis 1933
2.1 Jüdisches Leben und Emanzipation in Freiburg bis 1864
Um zu verstehen, welchen Stellenwert die jüdische Gemeinde und somit auch die Synagoge in Freiburg hatten, erscheint es notwendig, sich zunächst mit ihrer Entstehung und ihrer, im Vergleich zu anderen Gemeinden, sehr späten, rechtlich gesicherten Niederlassung in Freiburg zu befassen. [44] Dass im Jahr 1870 in Freiburg eine Synagoge errichtet werden konnte, ist eine Tatsache, die über Jahrhunderte hinweg als kaum denkbar erschien. So waren Juden zwar nachweislich schon in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts in Freiburg ansässig. [45] Ab dem Jahr 1338 gewährte ein „Sicherungsbrief“, auch ausgestellt durch die Stadt Freiburg, den Juden sogar Schutz und die Möglichkeit, ihren Tätigkeiten ohne größere Einschränkungen nachzugehen. Diese frühe Phase des interreligiösen Zusammenlebens endete jedoch Mitte des 14. Jahrhunderts, wie in anderen Teilen Europas auch, als die jüdische Bevölkerung im Zuge der großen Pestepidemien für diese verantwortlich gemacht und als sogenannte Brunnenvergifter verfolgt und ermordet wurde. [46] Nach zuvor erzwungenen Geständnissen wurden am 1. Januar 1349 alle Juden in Freiburg, mit Ausnahme schwangerer Frauen und Kinder, zunächst inhaftiert und am 30. Januar auf dem Scheiterhaufen verbrannt. [47] In der darauffolgenden Zeit und bis ins 19. Jahrhundert hinein, siedelten sich zwar vereinzelt und mit hohen persönlichen Einschränkungen verbunden wieder Juden in Freiburg an, von einer Anerkennung als gleichberechtigte Religionsgemeinschaft waren sie jedoch weit entfernt. Wenn einzelne Juden in Freiburg blieben, geschah dies auf Grundlage einer Duldung durch die Stadt, der viele Bürger ablehnend gegenüberstanden. Der Erwerb von Grundbesitz blieb den Juden zu dieser Zeit ebenso verwehrt wie die Aufnahme in die handwerklichen Zünfte. Diese beruflichen Beschränkungen, die ihnen bereits im frühen Mittelalter auferlegt worden waren, verhinderten die Integration der jüdischen Bürger in die Stadtgesellschaft bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts hinein zusätzlich. Eine allmähliche Veränderung zugunsten einer jüdischen Emanzipation ging mit den badischen Konstitutionsedikten ab 1807 einher, die den Umbrüchen der napoleonischen Zeit und der damit vollzogenen Vergrößerung des Landes Rechnung tragen sollten. So hob das erste Badische Konstitutionsedikt vom 14. März 1807 die Juden – zumindest formal – erstmals in den Stand gleichberechtigter Staatsbürger. Konkretisiert wurde diese Festschreibung in weiteren Edikten bis 1809. Das neunte Konstitutionsedikt vom 13. Januar 1809 sicherte den Juden des Großherzogtums Badens erstmals die Gleichstellung als Religionsgemeinschaft zu. Es beinhaltete die Ausführungsbestimmungen zu den vorangegangene Konstitutionsedikten und regelte mitunter die Organisation der jüdischen Gemeinden als „kirchliche Landesorganisation“ [48] . Dazu gehörte die Ausbildung einer geistlichen Oberbehörde, dem jüdischen Oberrat. Seine neun Mitglieder trafen sich einmal pro Jahr und sollten durch den jeweiligen Regenten berufen werden. [49] Bereits ein Jahr zuvor wurden sie mit dem sechsten Konstitutionsedikt zu „erbfreien Staatsbürgern“ erklärt, behielten jedoch den Status von „Schutzbürgern“ in ihren Gemeinden und waren demnach keine vollwertigen Gemeindebürger. [50] Konkret bedeutete dies, dass die Juden ihre Religion gleichberechtigt zu anderen ausüben durften, die Übernahme oder Ausübung von politischen Tätigkeiten ihnen aber nach wie vor untersagt war, ebenso wie der Eintritt in die handwerklichen Zünfte. Darüber hinaus konnten sich die Städte auf einen Absatz im sechsten Konstitutionsedikt von 1808 berufen, der besagt, dass Orte, in denen bislang keine Juden gelebt haben, sich nach wie vor das Recht vorbehalten können, den Zuzug derselben abzulehnen (Prinzip der Gemeindefreiheit). [51] Die Juden waren somit einmal mehr vom Wohlwollen der jeweiligen Stadt abhängig und konnten das Recht auf freie Wohnsitzwahl nur sehr bedingt in Anspruch nehmen. 1809 noch verweigerte Freiburg im Widerspruch zur damaligen badischen Verfassung den Juden, sich in der Stadt niederzulassen. [52] Immerhin jedoch war es dem jüdischen Gastwirt Heinrich Weil gestattet, in der Grünwälderstraße in Freiburg Fuß zu fassen, um durchreisenden Juden in einem Gasthof, den er zunächst er vom Wirt Lorenz Steiert, später von der Stadt, gepachtet hatte, koscheres Essen und Getränke anzubieten. Heinrich Weil gilt damit als erster sesshafter Jude Freiburgs, seine 1826 geborene Tochter als erste Freiburger Jüdin. [53]
Für die vorliegende Darstellung zentral erscheint die Tatsache, dass Juden als „erbfreie Staatsbürger“ fortan in der Lage waren, Grundbesitz zu erwerben und Gewerbe zu treiben. [54] Christiane Twiehaus, die eine Untersuchung zur Rezeption der Synagogen im Großherzogtum Baden von 1806 bis 1918 vorgelegt hat, geht davon aus, dass der Grund für die Blütezeit des Synagogenbaus in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts mitunter auf „die neuen Erwerbsmöglichkeiten durch die Stellung als Staatsbürger“ zurückzuführen ist. [55]
Nach weiteren Rückschlägen und politischen Entwicklungen, die der jüdischen Emanzipation und Liberalisierung in Baden entgegenwirkten, kam es 1846 zu einem zentralen Schritt, der von Reinhard Rürup auch als „Wende von 1846“ bezeichnet wurde. [56] Die politische und gemeindebürgerliche Gleichstellung von Juden wurde vor dem Hintergrund der Frage nach der Stellung der „Deutschkatholiken“, die sich von der katholischen Kirche abgespalten hatten, im badischen Landtag neu diskutiert. [57] Erstmals stimmten liberale Kräfte für die Gleichstellung. Die überwiegend katholische Opposition, die sich daraufhin auch in Freiburg formierte, legte zunehmend antisemitische Argumentationsmuster an den Tag, die zum Beispiel im „Süddeutschen Katholischen Kirchenblatt“ abgedruckt wurden und damit bewusst Stimmung gegen die Reform-Bemühungen des liberalen Lagers machten. [58] Mit der Revolution von 1848 schließlich kam es auch physisch zu teils heftigen Ausschreitungen und Anfeindungen gegen die jüdische Bevölkerung. Die pogromartigen Zustände wurden zum Anlass genommen, um die rechtliche Gleichstellung der Juden noch weiter zu verzögern, nämlich um „zuwarten, bis die jetzige, den Israeliten ungünstige und sehr stürmische Aufregung vorüber ist.“ [59] Am 27. Dezember 1848 verabschiedete die Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche die Grundrechte des deutschen Volkes. Die Landesrechte, die mit den Grundrechten nicht vereinbar waren, verloren daraufhin ihre Gültigkeit. So wurde auch in Baden am 13. Februar 1849 das Gesetz die Aufhebung der Beschränkung staatsbürgerlicher Rechte aus Rücksichten der Confession betreffend“ verabschiedet. [60] Zur praktischen Anwendung des eher ausweichend formulierten Gesetzestextes kam es jedoch erst viele Jahre später, wie der Fall des jüdischen Rechtsanwalts Nephtali Näf zeigt, der auf der Grundlage des neuen Gesetzes das Freiburger Ortsbürgerrecht erwerben wollte, daran aber zunächst scheiterte. [61] Erst am 4. Oktober 1862, unter maßgeblicher Mitwirkung des badischen Innenministers August Lamey, konnte schließlich das Gesetz zur Gleichstellung von Juden in Baden unterzeichnet werden, das wenige Tage später in Kraft trat. [62] Die Emanzipation der Juden in Baden gilt mit dem Gleichstellungsgesetz von 1862 als abgeschlossen, auch wenn die Gesetzgebung „noch nicht viel mehr als die Demonstration einer politischen Willensäußerung [war]“, wie Kathrin Clausing feststellt. [63]
Wie schon die Konstitutionsedikte Anfang des 19. Jahrhunderts stieß auch das neue Gesetz auf Ablehnung in ultramontanen und konservativen Kreisen, was in Freiburg durch eine Petition zum Ausdruck gebracht wurde. Darin forderten einige Bürger, das Prinzip der Gemeindefreiheit, nach dem es den Städten überlassen war, darüber zu entscheiden, ob Juden sich in der Stadt niederlassen dürfen, weiterhin aufrecht zu erhalten. [64] Das neue Gesetz trat jedoch auch gegen die erneuten Proteste der Opposition in Kraft und ebnete den Weg für die erste nachmittelalterliche Gemeinde in Freiburg. Das neue Gesetz gewährte den Juden eine bis dahin kaum gekannte Freizügigkeit und bewirkte, dass sich innerhalb weniger Jahre viele Juden, die bislang in den umliegenden Landgemeinden lebten, nach Freiburg zogen, um sich dauerhaft dort niederzulassen.
Mit der steigenden Bevölkerungszahl der Freiburger Juden ging der Wunsch nach einer Religionsgemeinde einher, die sich um die seelsorgerischen und Fürsorge-Belange ihrer Mitglieder kümmern sollte. So gründeten Freiburger Juden unter dem Vorsitz von Heinrich Zivi-Lang Anfang 1864 die „Israelitische Religionsgemeinschaft Freiburg“, die am 21. Oktober 1864 offiziell als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt wurde. [65] Am 11. Januar 1865 konnte erstmals ein Synagogenrat gewählt werden, wobei die Wahl auf Anraten des Bürgermeisteramtes unter Ausschluss der Öffentlichkeit, in der Stadt mehr oder minder unbemerkt abgehalten wurde. [66] Als erster Vorsteher wurde Adolf Weil benannt, zum Rabbiner wurde Adolf Lewin berufen, der die Gottesdienste vorerst in einem provisorisch angemieteten Betsaal am Münsterplatz (heute Hinterhaus zu Schusterstraße 27) abhielt. [67] Die neue Gemeinde wuchs kontinuierlich und zählte schon im Jahr 1871, dem Jahr der Reichsgründung, 333 Mitglieder. [68] Die Notwendigkeit einer eigenen Synagoge wurde mit folgender Passage in den Gründungsstatuten der Gemeinde schriftlich fixiert: „Sämtliche Einkaufsgelder fließen in die jetzt bestehende Synagogenbaukasse, sollte aber diese Casse fragliche Gelder nicht mehr nöthig haben, sollen solche in die Gemeindekasse fließen.“ [69] Hiermit war auch der finanzielle Grundstein für die spätere Errichtung einer Synagoge in Freiburg gelegt, die nur sechs Jahre später eingeweiht werden konnte.
2.2 Der Synagogenbau 1869/70
„Die festliche Weihe des neuen israelitischen Gotteshauses auf dem Rempart wurde gestern Abend programmäßig [sic!] begangen. Der schöne Bau, gleich der kleinen Gemeinde kühn aufstrebend in maurisch-byzantinischem Stil, ist ein lebendiges Beispiel, wie Gott mächtig ist im Kleinem [sic!]. [...] Baumeister (Herr Prof. Schneider) und Maler (Herr Fritz) haben für eine erkenntliche Gegenwart und eine dankbare Nachwelt gearbeitet.“ [70]
Freiburger Zeitung vom 25.09.1870
Die Alte Synagoge in Freiburg muss ein herausragender und für die Zeitgenossen als ästhetisch empfundener Bau gewesen sein, wie dieser Ausschnitt aus der Freiburger Zeitung anlässlich ihrer Einweihung zeigt. [71] Wie im vorangegangenen Kapitel deutlich wurde, war die Zeit bis zur tatsächlichen Erbauung des Gotteshauses von vielen Unwägbarkeiten und einer nur langsam voranschreitenden Emanzipation bis hin zur rechtlichen Gleichstellung der Juden in Freiburg geprägt. Wie konnte der Bau dennoch so schnell realisiert werden und wie wurde dieses Vorhaben von der Stadtgesellschaft aufgenommen?
Der Wunsch eines Synagogenbaus ging –
wie beschrieben – bereits mit der
Gründung der Israelitischen
Religionsgemeinschaft einher. Doch obwohl die Synagoge die
Freiburger Öffentlichkeit offenbar
entzückte, waren auch die Verhandlungen um
den Bau der Synagoge mit Herausforderungen
für die junge Gemeinde verbunden. Da bei der
Zerstörung der Synagoge im November 1938
eine Vielzahl von Dokumenten und
Überlieferungen, die die Geschichte und den
Bau der Synagoge von Seiten der Gemeinde zu dokumentieren
vermochten, verloren gegangen sind, ist eine
lückenlose Darstellung der damaligen
Vorgänge heute nicht mehr
möglich. [72] Es sind jedoch u.a.
ein Situationsplan, ergänzende
Erläuterungen vom 7. Juli 1869 sowie ein
Schreiben des Synagogenrats vom 26. Juli 1869 an den Gemeinderat
aus der frühen Planungsphase erhalten,
welche die Vorgänge aus Sicht der
städtischen
Überlieferung wiedergeben. [73] Die
Frage, zu welchem Zeitpunkt und unter welchen Bedingungen die
Liegenschaft am damaligen Stadtrand erstmals in den Besitz der
Israelitischen Gemeinde überging, kann
über einen Eintrag im Grundbuch der Stadt
Freiburg beantwortet werden. Darin ist vermerkt, dass die
Israelitische Gemeinde das Grundstück
Ende 1868 von „Frau Schreiner Karl Hug
Witwe Frida [...]“
für 5.000 Gulden erworben hat und diese
Weihnachten 1868 in ihren Besitz
übergegangen sind, um dort eine Synagoge
sowie ein Gemeinde- und Schulhaus zu errichten. [74] Das
Gelände lag damals
außerhalb der Altstadt, direkt neben einer
Brauerei und einer Kaserne. Eine befestigte
Straße war beim Ankauf des
Geländes noch nicht vorhanden. Allerdings
etablierte sich die Fläche westlich der
Altstadt – schon allein durch die
Eröffnung des Freiburger Bahnhofs 1845 zu
einem schnell wachsenden Teil der Stadt, der einer raschen Bebauung
unterzogen werden sollte. Neben der Synagoge, die im
südlichen Teil des
Grundstücks erbaut wurde, stand weiter
nördlich auch ein
„Wohnhaus“ auf dem
Gelände, das als Gemeindehaus genutzt wurde
und die Verwaltung der Religionsgemeinschaft beherbergte. Es ist
nicht bekannt, wann diese Bauten errichtet wurden, es ist jedoch
davon auszugehen, dass zumindest das Gemeindehaus schon auf dem
Gelände stand, als es durch die Gemeinde
1868 angekauft wurde. [75]
Aus den städtischen Akten geht hervor, dass es im Vorfeld des Synagogenbaus zu Unstimmigkeiten zwischen Stadt und Israelitischer Gemeinde kam. So war der Stadt vor allen Dingen daran gelegen, durch die Bebauung des Grundstücks, das sich zum damaligen Zeitpunkt zwar am Rande des Stadtzentrums aber dennoch in einer stadtplanerisch attraktiven Lage befand, keine Einschränkungen für künftige eigene Bauvorhaben in Kauf nehmen zu müssen. Die Stadt plante bereits während des Synagogenbaus die neue Straßenanlage des Werderrings. [76] Wenig später, in den Jahren 1910 und 1911, entstanden in unmittelbarer Nähe das repräsentative Stadttheater sowie der Neubau der Universität (heute Kollegiengebäude I). Dafür musste jedoch der Rempart, ein Überbleibsel der französischen Befestigungsanlage aus dem 17. Jahrhundert, abgetragen werden. Für das Grundstück, auf dem die Synagoge entstehen sollte, bedeutete dies, dass zusätzliche Böschungen, Treppen etc. angebracht werden mussten, für die die Israelitische Gemeinde selbst aufkommen sollte. Überdies forderte die Stadt die Gemeinde auf, ein zusätzliches, durch die Abtragung frei werdendes Gelände, das wohl an westlicher Seite an das Grundstück grenzte, zu einem von der Stadt noch zu bestimmenden Preis zu übernehmen. Während sich die Israelitische Gemeinde auf die erste Forderung einließ, die Reste der ehemaligen Befestigungsanlage auf eigene Kosten abtragen zu lassen, wollte sie der zweiten Forderung nicht sofort zustimmen. Zu Begründung hieß es:
„ Um einen der Stadt Freiburg würdigen und derselben zur Zierde gereichenden Bau herzustellen, muß sich die isr. Gemeinde weit über ihre Kräfte anstrengen, überdies stehen uns 1.) durch Abänderung des ursprünglichen Langbaus, 2.) Abtragung der 2 alten Gebäude, [...] noch bedeutende Überschreitungen des anfänglichen Kostenüberschlags bevor. Aus diesem Beweggrund wagen wir es mit der höflichen Bitte an den verehrlichen Gemeinderath heranzutreten, nur durch quasi zwangsweise Übertragung des frei werdenden Geländes nicht noch weitere, bedeutende Opfer aufbürden zu wollen, sondern uns fragliches Gelände unentgeltlich zu überlassen. [...]“ [77]
Der weitere Verlauf dieses Vorgangs ist ungewiss und kann über die städtischen Akten nicht nachvollzogen werden. [78] Gabriele Blod geht jedoch davon aus, dass es zu einem Ankauf des freigewordenen, zusätzlichen Geländes durch die Gemeinde kam und die Stadt Freiburg, im Gegensatz zu den Städten Basel und Konstanz, in dieser Sache nicht bereit war, Zugeständnisse in Richtung der Israelitischen Gemeinde zu machen. [79]
Amtlich erfasst wurde das Grundstück bei der Katastererstvermessung als Flurstück 475. Nach den Unterlagen der Kataster-Vermessung mit Stand vom 1. Juni 1900 betrug die Flurstückgröße 2.319 Quadratmeter. [80]
Mit dem Bau der Synagoge beauftragt wurde Georg Jakob Schneider, ein renommierter Freiburger Architekt, der sich nicht nur durch den solitären Bau der Villa Colombi von 1859-61, unweit der Synagoge, einen Ruf gemacht hatte. Christiane Twiehaus arbeitete heraus, dass Schneider für den Bau von insgesamt sechs badischen Synagogen verantwortlich zeichnete. Darüber hinaus erarbeitete er die Entwürfe für zahlreiche Kirchen- und Profanbauten im badischen Raum. Der Einfluss der Karlsruher Bauschule, an der er unter Friedrich Eisenlohr seine Expertise erlangte, ist unverkennbar. Der Rundbogenstil, eine Frühform des Historismus, der sich in Karlsruhe unter Heinrich Hübsch etablierte, wird auch der Freiburger Synagoge zugeschrieben. [81] Dennoch nimmt die Freiburger Synagoge unter den übrigen Synagogenbauten Schneiders einen besonderen Stellenwert ein. Er erbaute sie im „Rundbogenstil mit maurischen Motiven“, was die Zeitgenossen schon dazu veranlasste, sie als in rein „maurisch-byzantinischem Stil“ errichtet anzusehen. [82] Als einzige von Schneiders Synagogen war in Freiburg das Mauerwerk verputzt, weshalb die Synagoge insgesamt eleganter und urbaner wirkte. [83] Zwei angedeutete minarettartige Türme auf der Westseite des Gebäudes in einem sonst überwiegend im Rundbogenstil gehaltenen Bau grenzten ihn von anderen Sakralbauten, wie der barocken Jesuitenkirche (heute Universitätskirche) oder dem Münster klar ab. Vor allem die Türmchen an der Westseite erinnerten an maurische Architektur, was in der Synagogenbaukunst des 19. Jahrhunderts ein beliebtes Stilmittel war, um damit auf den geografischen Ursprung des jüdischen Glaubens zu verweisen. Der Innenraum war aufwändiger geschmückt als das Äußere und wies mit einer reich verzierten östlichen Wand hinter dem Aaron HaKodesch, dem Thoraschrein, wiederum maurische Stilelemente auf. [84]
Der Kunsthistoriker Harold Hammer-Schenk geht davon aus, dass Schneider den besonderen politischen Gegebenheiten in Freiburg beim Bau der Synagoge Rechnung tragen wollte. So zog Schneider unterschiedliche Stilelemente heran und schuf damit ein Gebäude, das sich repräsentativ, aber nicht zu auffällig in seine Umgebung einfügte. [85] Da er die Synagoge nicht im romanischen Stil erbaute, durch die Rundbogen jedoch darauf verwies, umging er eine mögliche Konkurrenz zum Münster und anderen Kirchenbauten und schuf doch Anknüpfungspunkte an christliche Kirchenbautraditionen. Eine rein orientalische Bauweise, wie sie in vielen städtischen Synagogen als Ausdruck eines selbstbewussten und aufstrebend-modernen Judentums zum Ausgang des 19. Jahrhunderts üblich war, hätte die Synagoge vielleicht zu sehr von im Stadtbild bereits vorhandenen Baustilen abgehoben. Der mit Arabesken versehene Innenraum sowie die beiden Türmchen an der Westseite greifen jedoch auch das Orientalische auf und verweisen somit auf den geografischen Ursprung des Judentums. [86] Diese Annahmen lassen sich heute aufgrund fehlender Pläne und Aufzeichnungen Schneiders nicht mehr belegen, doch erscheint diese Herleitung vor der bewegten Geschichte der jüdischen Gemeinde und ihrem Verhältnis zur Stadtgesellschaft als durchaus denkbar.
Bei der Planung des Grundrisses orientierte sich Schneider erstmals an Gottfried Semper, der für die Dresdener Synagoge die ungewöhnliche Form eines schwach ausgeprägten gleichseitigen Kreuzes wählte. [87] Diese für Sakralbauten damals ungewöhnliche Grundform grenzte den Bau zusätzlich von bestehenden Kirchenbauten ab und erinnerte dadurch mehr an ein repräsentatives bürgerliches Wohnhaus denn an einen Sakralbau. Zum Zeitpunkt der Errichtung fügte sich der feine, im Rundbogenstil mit maurischen Akzenten versehene Bau auch deshalb gut in das umliegende Gelände ein und bot damit zunächst wenig Angriffspunkte für Kritiker und antisemitische Äußerungen. [88]
Dies wird auch durch die öffentliche Berichtserstattung im Zuge der Einweihungsfeierlichkeiten belegt. Im eingangs auszugsweise zitierten Artikel über die Einweihung der Synagoge, in dem die Freiburger Zeitung zum ersten Mal überhaupt über die junge Glaubensgemeinschaft berichtet, klingt vielmehr sogar eine veränderte Haltung der Stadtgesellschaft an: Sie scheint geprägt von Zuspruch und Solidarität. Insgesamt sind zwölf Artikel aus der lokalen, regionalen und überregionalen Presse über die Einweihung der Synagoge überliefert, die alle sehr wohlwollend ausfallen. [89] Neben dem schon erwähnten Bericht aus der Freiburger Zeitung fällt in der Rezeption noch ein weiterer Bericht besonders ins Auge. So heißt es in der Badischen Landes-Zeitung:
„Unsere israelitische Gemeinde hat durch diesen mit großem Kostenaufwande ausgeführten Bau bewiesen, daß sie nicht nur für ihren religiösen Kultus Opfer zu bringen bereit ist, sondern auch fest u. bürgerlich treu für alle Zukunft die Stadt Freiburg als ihre Heimat festhalten will.“ [90]
Vor dem Hintergrund der bewegten Geschichte der jungen jüdischen Gemeinde in Freiburg bekommen die hier gewählten Formulierungen eine besondere Bedeutung. Twiehaus interpretiert sie als patriotisch und an anderer Stelle sogar als „propagandistisch“ [91] – gerade im Hinblick auf die laufende kriegerische Auseinandersetzung mit dem benachbarten Frankreich, gleichsam aber auch als Ausdruck eines Wunsches der christlichen Mehrheitsgesellschaft an die jüdischen Mitbürger nach Assimilation und Solidarität mit der „Heimat Freiburg“. [92] Dazu passt, dass in den öffentlichen Stellungnahmen zur Einweihung der Synagoge weniger deren architektonischer Wert als die politische Bedeutung eines jüdischen Gotteshauses im katholischen Freiburg anklang – als Zeichen eines modernen und offenen Staates. [93]
Rückblickend symbolisiert jene öffentliche Sichtbarkeit tatsächlich eine neue Stufe im Kontext der Entwicklung hin zu einer jüdischen Gemeinde, die ihren Platz in der Stadtgemeinschaft vorerst gefunden zu haben scheint. Dieser Optimismus, der sich auch in den Predigen und Schriften jüdischer Gemeindemitglieder widerspiegelt [94] und von der Perspektive einer hoffnungsvollen Zukunft geprägt ist, gipfelt in der weitgehend enthusiastischen Kriegsteilnahme jüdischer Bürger ab 1914, Seite an Seite mit ihren christlichen Kameraden. [95] Tatsächlich täuscht jener Optimismus jedoch über die Tatsache hinweg, dass antisemitische Tendenzen in der Bevölkerung Ende des 19. Jahrhunderts wieder zunahmen oder nie wirklich verschwunden waren. Auch wenn sich Antisemitismus im bürgerlichen und auf Tourismus angewiesenen Freiburg bis dahin nicht so offen gezeigt hat wie in anderen deutschen Städten, wurde er doch spätestens mit der Kriegsniederlage von 1918 auch dort zu einer neuen Bedrohung für die positive Entwicklung der wachsenden jüdischen Gemeinde. [96] Wie fragil und undefiniert der Status der Israelitischen Gemeinde in Freiburg so kurz nach ihrer Gründung tatsächlich gewesen sein muss, zeigen nicht zuletzt die zähen Verhandlungen um einen Anbau an die Synagoge ab 1912.
2.3 Der Erweiterungsbau von 1925
Im Vergleich zum Betrachtungsgegenstand des Synagogenbaus von 1870 liegen für die Zeit des Erweiterungsgesuchs eine ganze Reihe aufschlussreicher Quellen vor, die es ermöglichen, die Haltung der Stadt zum Standort der Synagoge an der Werderstraße am Beginn des 20. Jahrhunderts erstmals ausführlicher zu dokumentieren. [97]
Die jüdische Gemeinde in Freiburg wuchs seit der ab 1862 einsetzenden Landflucht stark an. So lebten nach einer Volkszählung im Jahr 1910 bereits 1320 Juden in Freiburg, was einem Bevölkerungsanteil von 1,6 Prozent entsprach. [98] Bis 1925 stieg diese Zahl noch einmal auf 1399 an, auch wenn damit nun ein insgesamt langsamerer Bevölkerungsanstieg zu verzeichnen war. [99] Im Hinblick auf die Größe der Israelitischen Religionsgemeinschaft ist es nicht verwunderlich, dass die Gemeindevorsteher bereits im März 1912 einen Antrag bei der Stadt auf einen Anbau der Synagoge stellten. [100] Vor allem der Zugang zur Frauenempore, der rechter und linker Hand des Hauptportals durch eine hölzerne Wendeltreppe angebracht war, barg mit dem Anwachsen der Glaubensgemeinschaft ein erhöhtes Einsturz- und Unfallrisiko. Wie aus der städtischen Überlieferung hervor geht, waren die Vertreter der städtischen Ämter von diesem Vorhaben jedoch alles andere als angetan. In einem Schreiben des Hochbauamtes an den Stadtrat vom April 1912 heißt es, dass die geplante Erweiterung der Synagoge nicht genehmigungsfähig sei. Diese Feststellung wird noch durch eine grundsätzliche Einschätzung zur Bausituation an der Werderstraße ergänzt:
„[...] Wir fügen noch bei, daß es uns überhaupt nicht im Interesse der Stadt zu liegen scheint, wenn die Synagoge an jener Stelle stehen bleibt und sogar noch erweitert wird, weil sie das ganze monumentale Straßenbild störend beeinflußt, da sie schräge zur Bauflucht der Hauptstraße (Werderstraße) steht. Dieser störende unschöne Eindruck würde aber noch wesentlich verstärkt werden, wenn die Synagoge nach der Werderstraße hin vorgebaut wird. Wir sind deshalb der Ansicht, daß dies seitens der Stadt mit allen Mitteln verhindert werden sollte. [...]“ [101]
Anschließend wird in dieser Stellungnahme noch darauf verwiesen, dass auf das Areal, auf dem die Synagoge und die benachbarte Löwenbrauerei-Aktiengesellschaft stehen, eigentlich „Geschäftshäuser mit schönen Läden, Caférestaurants im Erdgeschoss und Hotelräume in den Obergeschossen“ gehörten. Die Israelitische Gemeinde solle dafür am besten an anderer Stelle eine neue Synagoge errichten, zur Not mit Unterstützung der Stadt. [102] Sowohl die Inhalte als auch der Duktus dieses Schreibens verdeutlichen, dass die Diskussion um die Erweiterung des Synagogenbaus nicht nur bautechnisch sondern auch emotional hinsichtlich des Wunsches der Stadt nach einem „monumentalen“ Straßenbild geführt wurde. Die erst kürzlich errichtete und gefeierte Synagoge wird nun als „störend“ empfunden, eine Verlegung wird ganz unverhohlen in Kauf genommen. Tatsächlich hatte sich das Areal rund um die Synagoge in den letzten Jahren deutlich verändert. Neben dem Stadttheater, das zwischen 1905 und 1910 gegenüber der Synagoge erbaut wurde, entstand von 1907 bis 1912 auf dem südlichen Nachbargrundstück das neue und ausladende Universitätsgebäude. Neben diesen beiden Bauten erschien die filigrane Synagoge den Stadtplanern offensichtlich als unpassend. Die zähen und aus Sicht der Israelitischen Gemeinde ernüchternden Verhandlungen um die Bewilligung eines Anbaus zogen sich durch das Für und Wider der beteiligten Behörden über mehrere Jahre und wurden 1914 durch den Beginn des Ersten Weltkrieges unterbrochen. [103] Erst Mitte der 1920er Jahre konnten sie wieder aufgenommen werden. Am 21. März 1924 schrieb der Synagogenrat erneut an den Freiburger Stadtrat:
„Die unhaltbaren Zustände der Aufgänge zu den Frauenemporen unserer Synagoge zwingen uns, das Treppenhaus nach der Westseite hin zu erweitern und bei dieser Gelegenheit die Synagoge durch den Anbau einer Vorhalle zu vergrößern, um dadurch auch einige neue Plätze zu gewinnen. [...]“ [104]
Die grundsätzliche Haltung der Stadt zu dieser Sache jedoch schien sich im Vergleich zur Situation von 1912 nicht wesentlich geändert zu haben, gleichwohl sie eine Entscheidung für einen Anbau aufgrund der offensichtlichen Gefahrenlage durch die überlastete Holztreppe zur Frauenempore nun als zunehmend unumgänglich einschätzte. Langfristig aber sollte die Synagoge von diesem Platz weichen und an anderer Stelle als neues jüdisches Gotteshaus entstehen. [105] Diese Annahme wird durch eine Einschätzung des städtischen Hochbauamts vom März 1924 bestätigt:
„Das vorliegende Bauvorhaben wird sich nicht wohl hintenanhalten lassen, so sehr auch aus städtbaulichen Gründen zu wünschen wäre, dass das bauliche Durcheinander an der Werderstrasse zwischen Bertold- und Löwenstrasse recht bald verschwindet und einer geschlossenen, in den Rahmen der umgebenden Monumentalgebäude passenden Architektur Platz macht. Entgegen diesen, für die Gestaltung eines hervorragenden Punktes im Stadtbild recht wesentlichen Interessen bedeutet die Durchführung der geplanten Vergrößerung eine Festlegung des unerfreulichen Zustandes auf weitere lange Jahre hinaus. [...] Wir stellen daher den Antrag, der Stadtrat wolle vor endgültiger Entscheidung in dieser wichtigen, da öffentliche Interesse berührenden Frage die Vorlage der Fassadenpläne verlangen. Städt Hochbauamt.“ [106]
Die Pläne für den Anbau und somit auch für die Fassadengestaltung wurden von Arthur Levi, einem Freiburger Architekten angefertigt, der 1914 bereits die Pläne für eine Abortanlage neben der Synagoge sowie 1922 für eine Mikwe an der Nordostseite des Gemeindehauses entwarf. [107] Der Anbau der Synagoge sollte demnach in romanischem Stil umgesetzt werden. Die maurischen Akzente, die vor allem durch die beiden Türmchen an der Westseite bedingt waren, wurden durch den Rückbau der Türme minimiert. [108] Harold Hammer-Schenk geht davon aus, dass die Gemeinde somit auch auf die veränderte Bausituation an der Werderstraße mit ihren angrenzenden Monumentalbauten reagieren und sich diesen anpassen wollte. [109] Es liegt die Vermutung nahe, dass die rein romanische Ausführung des Baus auch eine Konsequenz aus den negativen Äußerungen der Stadt im Vorfeld des Anbaus gewesen ist.
Ende Juli 1924 stimmte der Stadtrat dem Baugesuch schließlich zu, nicht aber ohne daran die Erwartung zu knüpfen, „dass durch die jetzt beabsichtigten baulichen Veränderungen einer späteren Neugestaltung des ganzen Blocks zwischen Bertold-, Werder- und Löwenstraße, sobald es die wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben, ein Hindernis nicht erwachsen werde.“ [110]
Für die Umsetzung des Anbaus musste die Israelitische Gemeinde ein Darlehen in Anspruch nehmen. Ein Darlehen aus städtischen Mitteln war nicht möglich, jedoch stimmte die Stadt einem Darlehen der städtischen Sparkasse zu einem niedrigen Zinssatz zu. Auf diese Weise wurde der Israelitischen Gemeinde ein Darlehen in Höhe von 50.000 RM bewilligt zu einem Zinssatz von elf, später zwölf Prozent. [111]
Dass die Grundstücke an der Werderstraße schon zu dieser Zeit ein attraktives und deshalb begehrtes Gelände gewesen sind, verdeutlich auch folgender Vorgang: Die Sinner’sche Löwenbrauerei, die in unmittelbarer Nachbarschaft zum Gelände der Israelitischen Gemeinde eine Bierhalle mit Biergartenausschrank als Dependance des eigentlichen Brauereigeländes im Stadtteil Stühlinger betrieb, versuchte 1930 bei der Stadt die Baugenehmigung für mehrere kleine Verkaufsbuden zu erwirken, die sich entlang der Werderstraße erstrecken sollten. Die Stadt reagierte darauf zunächst mit Unwillen, würde dieses Bauvorhaben doch die eigentlichen Baupläne der Stadt zusätzlich durchkreuzen. In einer gemeinsamen Sitzung des Brauereidirektors Bayer mit einem Referenten des Bürgermeisters am 24. Juli 1930 schlug Bayer der Stadt eine Art Tauschhandel für die Erfüllung der Wünsche gleich beider Seiten (Stadt und Brauerei) vor, der aus dem Sitzungsprotokoll abzulesen ist:
„Der Unterzeichnete ließ erkennen, daß die Frage der verbreiterten Durchführung des Werthmannplatzes für die Stadtverwaltung nicht ein nur auf dem Papier stehender Plan, sondern ein ernstlich verfolgtes Ziel sei. Die Sinnersche Gesellschaft solle überlegen, in welcher Weise sie diesem Ziel, am dem sie ja auch ein großes Interesse habe, dienen wolle.
[...]
Direktor Bayer erklärte, daß über die etwaige Geländeabtretung [der Brauerei an die Stadt, Anm. JW] jederzeit dann eine Verständigung möglich sein werde, wenn die Gesellschaft dafür auf dem Nachbargrundstück entschädigt werde, das jetzt noch der israelitischen Gemeinde gehöre, das aber von der Stadt sicherlich erworben werden müsste, wenn sie in der aufgeworfenen Frage zu einer Lösung kommen wolle. [...]“ [112]
Die Stadt ging auf diesen Vorschlag von Bayer nicht näher ein. Der Vorgang verdeutlicht aber zum einen, mit welcher Selbstverständlichkeit auch lokale Unternehmer davon ausgehen konnten, dass das Areal rund um die Synagoge alsbald den Besitzer wechseln würde und zum anderen, dass die Überlegungen und Entscheidungen dazu auch ohne den Einbezug des Synagogenrats oder weiterer Mitglieder der Israelitischen Gemeinde vonstattengehen könnten.
Vor diesem Hintergrund muss schließlich auch die Einschätzung von Kathrin Clausing, dass es beim Ankauf des Synagogenareals im März 1939 wahrscheinlich keine Mitbewerber gegeben hat, zumindest infrage gestellt werden. Begehrlichkeiten weiterer Anrainer sind aufgrund des oben beschriebenen Vorgangs zumindest nicht ausgeschlossen. Dies würde das offensive Vorgehen der Stadt beim späteren Ankauf des Areals zusätzlich begründen. [113]
Ein weiterer Aspekt tritt in der Korrespondenz rund um das Baugesuch der Sinner’schen Brauerei, diesmal am 22. Januar 1931, zu Tage. Der Bezirksrat machte bezüglich einer zuvor eingereichten schriftlichen Beschwerde gegen das Baugesuch der Löwenbrauerei A.G. nämlich noch einmal unverhohlen deutlich, wie der „Traum“ der Stadt und der angegliederten Behörden zuständigen bzgl. des Areals aussieht:
„Amt und Bezirksrat kennen den alten Wunsch der Stadt, den Rotteck- und Werthmannplatz durch einen breiten Straßengang zu verbinden, wohl. Sie würden es auch – schon im Interesse der Behebung der Arbeitslosigkeit lebhaft begrüßen, wenn die Stadt bald an dies grosse Werk, das den Abbruch der erst vor einigen Jahren erweiterten Synagoge und drei mehrstöckiger Wohnhäuser nördlich der Bertholdstraße zur Voraussetzung hat, herantreten könnte. Beide Stellen glauben jedoch nicht, dass sich dieser Traum in irgendwie absehbarer Zeit erfüllen lassen wird.“ [114]
Der Wunsch nach dem „Abbruch der Synagoge“ wurde hier erstmals schriftlich geäußert. Die Vermutung liegt nahe, dass der Brand im November 1938 sowie der daran schließende Abriss der Synagogenruine der Stadt sowie weiteren am Platz vertretenen Interessenten ganz besonders in die Hände gespielt haben musste. Dabei stellt sich die Frage, inwieweit die Motivlagen von 1931 mit denjenigen ab 1933 in Verbindung standen, bzw. ob schon vor 1933 antisemitische Motive den Wunsch der Stadt, die Synagoge an dieser Stelle möglichst zu entfernen, eine Rolle gespielt haben könnten oder nicht. Aus den städtischen Akten sind antisemitische Motive, den Bau und die Erweiterung der Synagoge betreffend, nicht eindeutig abzulesen. Die damit verbundenen Fragen gilt es im Rahmen der folgenden Kapitel näher zu betrachten.
3. Entrechtung, Zerstörung, Verfolgung – Die schrittweise Verdrängung jüdischen Lebens aus Freiburg 1933–1938
3.1 Zur allgemeinen Situation für die Freiburger Juden 1933–1938
Um die verbrecherischen Geschehnisse rund um die Pogromnacht von 9. auf 10. November 1938 in den Kontext der ab 1933 einsetzenden, schrittweisen Entrechtung und Enteignung der jüdischen Bevölkerung einordnen zu können, sei im Folgenden ein kursorischer Überblick über die Verläufe dieses gesellschaftlichen Ausschlusses dargelegt. [115] Dabei können nicht alle, für die Betrachtung dieser Zeitspanne relevanten Schritte in Gänze abgebildet werden, vielmehr sollen deshalb besonders diejenigen Gesetze und Entwicklungen in den Blick genommen werden, die eine unmittelbare Bedeutung für das jüdische Gemeindeleben im Umfeld der Synagoge, die „Arisierungsvorgänge“ sowie die Kommunikation zwischen Israelitischer Gemeinde und städtischen Behörden gehabt haben.
Mit der „Machtergreifung“ [116] Adolf Hitlers am 30. Januar 1933 begann nicht nur die schrittweise Abkehr von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Deutschland. Es war vor allem die Lebenssituation der Jüdinnen und Juden sowie die derjenigen Menschen in Deutschland, die nicht dem rassistischen Ideal des „Arischen“ entsprachen, die sich ab diesem Tag nahezu täglich verschlechterte. Die sukzessive gesellschaftliche Ausgrenzung von Jüdinnen und Juden, die später im millionenfachen Mord endete, begann bereits wenige Monate nach der Ernennung Hitlers zum Reichkanzler – unter anderem mit gezielten Boykottmaßnahmen gegen jüdische Geschäfte und Einrichtungen. [117] In Freiburg wurden im Rahmen des durch die propagandistische Presse verbreiteten Aufrufs um Boykott jüdische Geschäfts- und Kaufhäuser mit antisemitischen Hetzparolen beschmiert, Kunden wie Besitzer eingeschüchtert und ihre Läden zu vorübergehenden Schließungen veranlasst. Der am 9. April 1933 nach einer gezielten Hetzkampagne durch Mitglieder der NSDAP beurlaubte Freiburger Oberbürgermeister Otto Bender wurde bereits am darauffolgenden Tag durch Franz Kerber abgelöst. Dieser war schon 1930 in die NSDAP eingetreten und verfolgte als Hauptschriftleiter des antisemitischen und propagandistischen Nachrichtenblattes „Der Alemanne“ einen strengen nationalsozialistischen Kurs. [118] Wenige Tage nach seiner Amtseinführung richteten sich Kerbers erste antisemitische Maßnahmen u.a. gegen das rituelle Schächten, jüdische Literatur und eben auch jüdische Kaufhäuser. [119] Während die Boykottmaßnahmen jedoch im Hinblick auf die angeschlagene wirtschaftliche Lage des Reiches von der Parteiführung im Nachhinein als wenig zielführende Maßnahme angesehen wurde, schritt die Diskriminierung und sofort spürbare Entrechtung auf anderen Gebieten weiter voran: Mit dem „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ vom 7. April 1933 und drauffolgenden Durchführungsverordnungen, die im Mai veranlasst wurden, ging die Diskriminierung und Entlassung von „nicht-arischen“ Beamten einher. [120] In Freiburg wurde sogar noch vor dem Inkrafttreten des auf Reichsebene wirksamen Gesetzes veranlasst, alle jüdischen Lehrkräfte zu entlassen. [121] Darüber hinaus wurde die Anzahl der neuaufgenommenen jüdischen Studierenden pro Jahrgang auf 1,5% der „arischen“ Studierenden reduziert. [122] Grundlage dafür bildete das „Gesetz gegen die Überfüllung von deutschen Schulen und Hochschulen“, das durch das badische Kultusministerium im April 1933 verabschiedet wurde. [123] Auch für freiberuflich Tätige, wie jüdische Ärzte, Anwälte, Steuerberater, Architekten etc. gestaltete sich das Ausüben ihrer Berufe immer schwieriger. [124] Mit den Nürnberger Gesetzen von 1935 schufen die Nationalsozialisten schließlich ein Instrumentarium, um ihre rassistische Diskriminierungspolitik auch juristisch legitimiert umsetzen zu können. Waren gerade die Boykottaktionen vom April 1933 noch von einer gewissen Unsicherheit geprägt, welches Geschäft nun eigentlich als „jüdisch“ anzusehen und deshalb zu boykottieren war, wurde von nun an gesetzlich und unter Bezugnahme auf eine pseudowissenschaftliche Rassenlehre geregelt, wer als Jude und wer als „Arier“ zu gelten hatte. [125] Juden wurden daraufhin zu Bürgern zweiter Klasse degradiert: Während „arische“ Bürger als „Reichsbürger“ firmierten, stand Juden lediglich der Status der „Staatsbürger“ zu [126] – eine Entwicklung, die schmerzlich an die Phase der mühsam und erst kürzlich errungenen Emanzipation bis 1862 erinnert. [127]
Einen besonderen Stellenwert für die vorliegende Betrachtung haben die Vorgänge der sogenannten Arisierung. Die Enzyklopädie des Nationalsozialismus, herausgegeben von Wolfgang Benz, Hermann Graml und Herrmann Weiß spricht von „Arisierung“ als einem „nat.soz. Begriff für den Prozess der Entfernung der dt. Juden aus dem Wirtschafts- und Berufsleben.“ [128] Dabei umfasse sie sowohl die Enteignung jüdischen Besitzes und Vermögens zugunsten von Nichtjuden ebenso wie die Einschränkung jüdischer Erwerbstätigkeit oder den direkten Zugriff auf jüdisches Vermögen. [129] Die „Arisierung“ wird in der historischen Forschung heute als eine fokussierte Maßnahme der Nationalsozialisten innerhalb eines dynamischen und teilweise unkoordinierten Ausschlussprozesses der Juden aus der deutschen Gesellschaft angesehen. Ein Prozess, in dem die Grenzen zwischen wirtschaftlichen, sozialen oder juristischen Maßnahmen nicht immer trennscharf gezogen werden können. [130] In der Geschichtswissenschaft hat sich in der Folge deshalb die Benutzung des Begriffs in einer eher weiten Definition durchgesetzt, die ein umfassendes Bild von Verdrängung, Enteignung und Vertreibung zeichnet, mitunter sogar die Deportationen ab 1941 umfasst. [131] Obwohl der Begriff „Arisierung“ in der Geschichtswissenschaft die propagandistische Sprache der Nationalsozialsten aufgreift und sie auf diese Weise reproduziert, hat sich bislang keine konsensfähige Alternative durchsetzen können. [132] Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird unter „Arisierung“ die Enteignung der jüdischen Bevölkerung aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten zugunsten der „arischen“ Mehrheitsgesellschaft verstanden, die neben dem zwangsweisen Verlust von privatem, unternehmerischem oder institutionellem Besitz auch den Verlust von Arbeitsplätzen und beruflichen Positionen einschließt.
Schon ab 1933 kam es zu teilweise erzwungenen oder durch die wirtschaftlichen Verhältnisse unvermeidlich gewordenen Verkäufen von jüdischem Eigentum an „arische“ Besitzer. Diese erste Phase der „Arisierung“, die auch als „schleichende Arisierung“ [133] bezeichnet wird, vollzog sich überwiegend im Stillen und ohne rechtliche Grundlage, da der Verkauf von jüdischen Immobilien und Wirtschaftsgütern bis ins Jahr 1937 nicht unter staatlicher Steuerung erfolgte. [134] Gleichwohl hatten die schon zu dieser Zeit zunehmenden Einschränkungen für Juden natürlich einen erheblichen Einfluss auf die Bereitschaft der jüdischen Besitzer, ihr Eigentum schnell, wenn nötig unter Wert, zu verkaufen, zum Beispiel um eine Ausreise und einen Neuanfang im Ausland finanzieren zu können. Davon profitierten nicht nur private „arische“ Neubesitzer sondern in besonderem Maße auch Kommunen und Parteiorgane der NSDAP. [135] Die Verkaufsbedingungen für die jüdischen Eigentümer verschlechterten sich zusehends. Grund hierfür waren nicht nur die anwachsende Ausgrenzung aus dem öffentlichen Leben und der damit einhergehende Statusverlust, sondern auch die wirtschaftlichen Einbußen als Folge von Boykottaktionen, Umsatzrückgängen und Gewerbebeschränkungen. [136] Nach der 1937 einsetzenden Vollbeschäftigung war die Reichsführung nicht länger auf die Schonung jüdischer Betriebe zum Zwecke der wirtschaftlichen „Gesundung“ des Reiches angewiesen. Staatliche Investitionen wie der Autobahnbau oder Steuererleichterungen für Landwirtschaft, Wohnungsbau und Automobilindustrie trugen mit dazu bei, die Arbeitslosenzahlen von rund fünf Millionen im Jahr 1933 auf unter eine Million Erwerbslose im Jahr 1937 zu senken. [137] Mit dem Narrativ des eingelösten Wahlkampfversprechens von 1933 konnte die NSDAP nun auf noch mehr Zuspruch aus der Bevölkerung hoffen und nutzte dies, um ihre wirtschaftlichen Interessen vor allem in Richtung Aufrüstung und Autarkie zu steuern. Zwischen November 1937 und April 1938 setzte eine Radikalisierung der nationalsozialistischen Arisierungspolitik ein, die mit der Umsetzung des 1936 von Hitler initiierten und von Hermann Göring koordinierten Vierjahresplanes für die Wirtschaft in Zusammenhang steht und sich mit der Amtsübernahme Walther Funks als Reichswirtschaftsminister noch einmal verschärfte. [138] Jüdisches Vermögen und Eigentum sollte – so die perfide Vorstellung – möglichst schnell und umfassend dem „deutschen Volkskörper“ zugeführt, die Situation für die „Reichsbürger“ verbessert und die Wirtschaft des Landes damit weiter saniert und für den bevorstehenden Krieg vorbereitet werden. [139]
In Freiburg stellten sich die Verhältnisse in diesem Zusammenhang anders dar als im Rest des Reichsgebiets: Hier wurden Verschärfungen in der „Arisierungspolitik“ sowie ein erhöhter Verfolgungsdruck auf jüdische Unternehmen und Einrichtungen schon einige Monate früher vorgenommen. [140] Bis Ende 1937 nämlich galt eine Vielzahl jüdischer Betriebe in Freiburg bereits als „arisiert“. [141] Wie Andrea Brucher-Lembach anhand von Freiburger Einzelfallakten nachwies, hatte Johann Stöckinger darauf entscheidenden Einfluss: Als neu berufener Oberregierungsrat des badischen Finanz- und Wirtschaftsministeriums bildete seine Person eine Kontrollinstanz lokaler Arisierungsvorgänge. Für die „Arisierung“ in Freiburg war damit fortan das badische Wirtschafts- und Finanzministerium in Karlsruhe zuständig. Alle Kaufinteressenten mussten sich mit dieser Behörde, bzw. mit Stöckinger persönlich in Verbindung setzen, um ihre „Kaufwünsche“ über jüdisches Eigentum anzumelden. In dieser Funktion brachte sich Stöckinger in einzelne Abläufe stets zum Vorteil „arischer“ Interessenten sowie zum Nachteil der jüdischen Verkäufer ein. [142]
Mit der Verordnung über die Erfassung jüdischer Vermögenswerte trat am 26. April 1938 eine Regelung in Kraft, die auch auf Reichsebene eine erneute Verschärfung der wirtschaftlichen Situation für die jüdische Bevölkerung bedeutete. Diese sollte als „Grundlage einer sachgemäßen und planvollen Arisierung“ [143] dazu dienen, sämtliche jüdische Vermögenswerte zu erfassen, um sie später systematisch dem Reichsvermögen zuführen zu können. Diese Verordnung wird auch bei der Frage nach der sogenannten Verwertung des jüdischen Gemeindevermögens in Freiburg eine Rolle spielen. [144] Es folgten zahlreiche weitere Gesetze, wie eine Anordnung vom 26. April 1938, die besagte, dass alle Kaufverträge, an deren Vertragsabschluss eine jüdische Seite beteiligt war, von einer übergeordneten Behörde offiziell genehmigt werden mussten. [145] Was Stöckinger schon seit einigen Monaten sehr erfolgreich in Baden umsetzte, wurde mit diesem Gesetz auch auf Reichsebene zu einer bewährten Praxis systematischer Enteignung. [146]
Ein Umstand der für die Israelitische Religionsgemeinschaft von nicht unerheblicher Bedeutung war, ist die Erlassung des Gesetzes über die rechtliche Stellung der jüdischen Kultusvereinigungen vom 28. März 1938, nach dem alle jüdischen Kultuseinrichtungen, und somit auch die Israelitische Religionsgemeinschaft Freiburg, ihren Status als öffentlich-rechtliche Körperschaften verloren. [147] Ab diesem Zeitpunkt traten sie lediglich noch als „rechtsfähige Vereine des bürgerlichen Rechts“ in Erscheinung und konnten nicht länger von steuerlichen und weiteren üblichen Vergünstigungen, wie sie sie als Körperschaft des öffentlichen Rechts erhalten hatten, profitieren. [148] Vormals als Beamte angestellte Mitglieder der Gemeinde wurden nun Angestellte des bürgerlichen Rechts. Auch auf dieser Ebene war damit nun ein ähnlicher rechtlicher Status erreicht, wie er vor der Emanzipationsbewegung Ende des 19. Jahrhunderts galt.
Alle diese Maßnahmen erlangten mit der Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 einen weiteren traurigen Höhepunkt. Die sukzessive Entrechtung und Demütigung brach sich in dieser Nacht bahn in bis dahin beispielloser Gewalt gegen die jüdische Bevölkerung und ihr Eigentum.
3.2 Die Zerstörung der Synagoge in der Pogromnacht von 1938 und die einsetzende staatliche „Arisierung“
In den frühen Morgenstunden des 10. November 1938 wurden der Freiburger Rabbiner Dr. Siegfried Scheuermann, der Kantor David Ziegler sowie der Vorsteher des Synagogenrats Löb David Maier aus ihren Wohnungen gezerrt und zur Synagoge an der Werderstraße gebracht. Dort mussten sie mit ansehen, wir die Synagoge in Flammen stand. Die Feuerwehr wurde laut Zeugenaussagen von den Brandstiftern dazu angehalten, die brennende Synagoge nicht zu löschen. [149] Lediglich die umliegenden Gebäude, wie das der Universität, sollten durch die Feuerwehr geschützt und ein Übergreifen der Flammen verhindert werden. [150] Wenige Stunden nach dieser Demütigung wurden die drei Männer gemeinsam mit 134 anderen männlichen Freiburger Juden überwiegend von SA-Mitgliedern Gefangen genommen und zunächst in unterschiedliche SA-Lokale, dann zentral ins Kornhaus am Münsterplatz und später in das Freiburger Gefängnis gebracht. [151] Von dort aus wurden sie, nach teilweise schweren Misshandlungen, am Abend des 10. November in das Konzentrationslager Dachau deportiert. [152] Erst nach mindestens sechs Wochen und unter der Auflage, das Land schnellstmöglich zu verlassen sowie ihren Besitz zu veräußern, durften sie nach Freiburg zurückkehren. [153] Zwei der am 10. November deportierten Freiburger Juden starben noch in Dachau. [154] Die Rückkehrenden fanden, gedemütigt und gequält, eine veränderte Stadt vor, in der sie künftig weder auf eine religiöse Heimstatt noch auf eine Veränderung ihrer dramatischen Lage hoffen konnten.
Die Vorgeschichte der Reichspogromnacht ist in der historischen Forschung vielfach untersucht und beschrieben worden. [155] Dabei eint die Mehrheit der Darstellungen die Interpretation dieses Verbrechens als „Wende“, „Radikalisierung“ oder neuer „Höhepunkt“ der nationalsozialistischen Ausgrenzungspolitik. [156] Das Datum ist in diesem Zusammenhang jedoch als eine eher zufällige Wegmarke einzuschätzen. So bot die Ermordung des deutschen Gesandtschaftsrats Ernst Eduard vom Rath durch den 17-jähringen, deutsch-polnischen Juden Herschel Grynszpan in Paris der NS-Führung einen willkommenen Vorwand, um gegen die schon zu dieser Zeit um fast alle Rechte beschnittene jüdische Bevölkerung in Deutschland mit einer bis dahin ungekannten Brutalität und Unmenschlichkeit als einer Art „Vergeltungsakt“ vorzugehen. [157] Wer auf Reichsebene genau den Anstoß für die Aktionen in der Nacht auf den 10. November gegeben hat und wer an ihrer Umsetzung tatsächlich mit beteiligt war, gilt heute als nicht eindeutig nachweisbar. [158] Jedoch ist der maßgebliche Einfluss Joseph Goebbels, in seiner Funktion als Reichspropagandaminister und enger Vertrauter Hitlers, auf Intensität und Verlauf der Ausschreitungen unbestritten. [159] Am Abend des 9. November 1938 hielt er sich gemeinsam mit Hitler in München auf, um einer abendlichen Veranstaltung beizuwohnen. Als der Tod Raths gegen 21 Uhr bekannt wurde, zogen sich Hitler und Goebbels zu einem „intensiven Gespräch“ zurück. Wenig später ließ Goebbels in einer öffentlichen Rede, die er auszugsweise in seinen Tagebucheinträgen festhielt, verkünden, Hitler habe „auf seinen [Goebbels’, Anmerkung J.W.] Vortrag entschieden, daß derartige Demonstrationen von der Partei weder vorzubereiten, noch zu organisieren seien, soweit sie spontan entstünden, sei ihnen aber auch nicht entgegenzutreten.“ [160] Es sollte nach einem spontanen „Volkszorn“ aussehen, der sich in dieser Nacht gegen die deutschen Juden richten sollte. Daraufhin ergingen, teilweise unkoordiniert, Weisungen zunächst an die Gauleiter (ab 22.30 Uhr), dann an die SA, die Gestapo sowie ab ca. 1.30 Uhr an die SS. [161] Laut den überlieferten Anweisungen Reinhard Heydrichs sollten Synagogen, jüdische Wohnungen und Eigentum zerstört werden, mit der Einschränkung, dass deutsches Eigentum dabei keinen Schaden nimmt. [162] Außerdem galt es, Archivmaterial aus den Synagogengemeinden sicherzustellen und dem Sicherheitsdienst zu übergeben. [163] Verboten waren hingegen Plünderungen, was vor dem Hintergrund der tatsächlichen Geschehnisse fast zynisch wirkt.
Der Brand der Freiburger Synagoge brach zwischen drei und vier Uhr morgens aus. [164] Als Brandstifter wurden im Nachhinein der SS-Standartenführer Walter Gunst sowie weitere SS-Mitglieder ausgemacht. [165] Die SA mit SA-Brigardeführer Joachim Weist aus Freiburg kam später hinzu, um die Brandstelle abzusperren. Weist und Gunst gaben später die Weisung heraus, auch die Synagogen in den umliegenden Ortschaften zu zerstören. [166] Alle Täter waren dazu angehalten, nicht in Uniform zu erscheinen und am besten auswärtig zu sein, um möglichst unerkannt bleiben zu können. Auf diese Weise sollte eine Beteiligung von NSDAP-Organen verschleiert werden. [167] In Freiburg verschafften sich die Männer zunächst gewaltsam Zutritt zum Gemeindehaus der Israelitischen Religionsgemeinschaft am Werthmannplatz 1 und verwüsteten die dort befindlichen Gemeinde- und Wohnräume, wohl auf der Suche nach den Schlüsseln für die Synagoge. Wenig später drangen sie in die Synagoge ein, legten Feuer und entwendeten Archivmaterialien und weitere Dokumente aus dem Keller der Synagoge. [168] Aus der Synagoge konnten lediglich ein Kronleuchter, die hölzernen Außentüren sowie die steinernen Gesetzestafeln vor der Zerstörung gerettet werden. [169] Am nächsten Morgen bot sich den Freiburgern an der Werderstraße ein Bild der Verwüstung. Die Synagoge war innen komplett ausgebrannt, das Dach war eingestürzt. Das Gelände wurde von der Polizei weitgehend abgesperrt. Die Außenmauern der Synagoge waren am Morgen des 10. November aber zumindest teilweise noch gut erhalten. Dies belegt eine 2018 bekannt gewordene Fotografie, die auf den 12. November 1938 datiert ist, wohl aber bereits am 10. November 1938 aufgenommen wurde und die Südseite der Synagoge in Richtung Norden fotografiert zeigt. [170] Diese Fotografie stammt von dem damals in der erzbischöflichen Finanzverwaltung tätigen Josef Vollmer. [171] Galt eine Fotografie des ehemaligen NSDAP-Mitglieds und späteren Juristen Wolf Middendorff [172] bis vor Kurzem als einzig überlieferte Abbildung des zerstörten Synagogengeländes [173] , trat mit der neuen Fotografie von Vollmer eine gänzlich neu zu bewertende historische Sachlage zu Tage: Die Zerstörung der Synagoge war am Morgen des 10. November längst nicht so umfassend gewesen, wie dies in der bis dahin tradierten Aufnahme von Wolf Middendorff erschien. Middendorffs Aufnahme musste demnach zu einem späteren Zeitpunkt, also zwischen dem Nachmittag des 10. Novembers und dem Abend des 11. Novembers gemacht worden sein. Der Zustand der Synagoge, wie ihn Vollmer fotografierte, legt die Vermutung nahe, dass ein Abriss des Gebäudes aus statischen Gründen nicht unbedingt notwendig gewesen wäre. Jedoch lag es sicherlich nicht im Interesse der nationalsozialistischen Stadtführung, die Synagoge zu erhalten. Die Brandruine wurde im Auftrag der Stadt deshalb zügig gesprengt. [174] Wie den Aufzeichnungen der Journalistin und Zeitzeugin Käthe Vordtriede zu entnehmen ist, wurden die Reste der ausgebrannten Synagoge rasch abgetragen und der übrig gebliebene Schutt später für den Straßenbau verwendet. [175] Die Freiburger Öffentlichkeit reagierte – das zumindest legen die meisten Zeugenaussagen nahe – verhaltend bis ablehnend auf die Ausschreitungen und die offene Gewalt. Das Image der Stadt als kulturelles und touristisches Zentrum im Südwesten des Landes stand auf dem Spiel. [176] Gleichzeitig hat es jedoch keine private oder öffentliche Stellungnahme (z.B. von Seiten der Kirchen) gegeben, die die Vorgänge verurteilt hätte. Clausing geht davon aus, dass das Schweigen über die zerstörerischen Maßnahmen alleine jedoch schon als eine Absage an diese Form der Politik gewertet werden kann. [177]
Bis zum 9. November 1938 standen auf dem Gebiet des Deutschen Reiches ca. 2.800 Synagogen und jüdische Bethäuser. Mindestens 1.400 von ihnen wurden in der Nacht von 9. auf den 10. November 1938 niedergebrannt oder schwer beschädigt. [178] Rund 7000 jüdische Geschäfte wurden reichsweit demoliert, laut offiziellen Angaben kamen dabei 91 Menschen ums Leben. [179] Unmittelbar nach dem Pogrom wurden ca. 26.000 männliche Juden in die KZs Buchenwald, Sachsenhausen und Dachau deportiert. Für den entstandenen Sachschaden sollten die Juden unmittelbar selbst aufkommen. Diese Anordnung war ein Teil einer ganzen Reihe von Verordnungen, die den Juden u.a. als „Sühneleistung“ aufgebürdet werden sollte. Nach einer Besprechung am 12. November 1938 in den Räumen des Reichsluftfahrtministeriums in Berlin, an der neben Heydrich auch Herrmann Göring teilnahm, ordnete Göring den Erlass zahlreicher Maßnahmen an, die alle das Ziel verfolgten, Deutschland „judenfrei“ zu machen. [180] Neben der bereits erwähnten „Sühneleistung“, die mit einer Milliarde Reichsmark veranschlagt war, wurden Juden von nun an vollständig aus dem Wirtschaftsleben ausgeschlossen. [181] Mit der „Sühneleistung“, die pauschal „Judenvermögensabgabe“ genannt wurde, sollten die Juden für die ihnen durch die SA angetanen Verbrechen und Zerstörungen selbst aufkommen. So sollten 20 % des bereits im Frühjahr 1938 angemeldeten jüdischen Besitzes in mehreren Raten durch die lokalen Finanzämter und ohne Gewährung von Aufschub von allen Juden eingezogen werden. [182] Für viele Juden, auch in Freiburg, bedeutete diese Abgabe den finalen Schritt in die Mittellosigkeit. Grundbesitz musste schnellstens, oftmals weit unter Wert verkauft werden, um die Summe überhaupt irgendwie aufbringen zu können. [183] Die Versicherungssummen für die in der Nacht auf den 10. November zerstören Geschäfte oder Privathäuser wurden ebenso direkt vom Reich beschlagnahmt. [184] In Freiburg wurde die Israelitische Gemeinde zusätzlich dazu gezwungen, die verwüsteten Räume des Gemeindehauses mit eigenen Mitteln wieder in Stand zu setzen. [185] Dies entspricht der grundsätzlichen Haltung der NSDAP, die Juden als die eigentlichen Verantwortlichen für die gewaltsamen Ausschreitungen anzusehen und dies auch öffentlich so zu verbreiten. In anderen Städten, wie zum Beispiel in Wien, wurden Juden dazu gezwungen, öffentlich und unter Aufsicht städtischer Behörden, Schutt und Schmutz selbst zu entfernen und das Stadtbild auf diese Weise wiederherzustellen. [186]
Am 3. Dezember 1938 folgte ein weiterer, schwerwiegender Einschnitt in das Leben der Juden in Deutschland. Die „Verordnung über den Einsatz des jüdischen Vermögens“, die sich auf die Verordnung vom 12. November bezog, verpflichtete Juden mitunter gesetzlich dazu, sämtliche, noch in ihrem Besitz befindlichen Aktien, Wertpapiere etc. in ein Depot einzulagern und anzumelden. Darüber hinaus wurde gesetzlich verfügt, dass Juden aufgegeben werden kann, ihr „Grundeigentum oder andere Vermögensteile ganz oder teilweise binnen einer bestimmten Frist zu veräußern“ [187] . Außerdem bedurfte die Verfügung über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte durch Juden zu ihrer Wirksamkeit einer Genehmigung durch die zuständige Behörde, auch wenn ein Treuhänder als Zwischeninstanz eingeschaltet wurde. [188] Ausdrücklich galt diese Verordnung nicht nur für Gewerbebetriebe sondern bezog sich ebenso auf „Vereine, Stiftungen, Anstalten und sonstige Unternehmen, die nicht Gewerbetriebe sind, sowie sie nach der Dritten Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 14. Juni 1938 als jüdisch gelten.“ [189]
Ab diesem Tag oblag es also nun auch offiziell den zuständigen Behörden, grundsätzlich über die Frage eines Verkaufs und darüber hinaus über den Zeitpunkt dieses Verkaufs zu bestimmen. Jüdische Eigentümer hatten demnach keinen rechtlichen Zugriff mehr auf ihren Grundbesitz und waren von den Bestimmungen der ausführenden Behörden abhängig. Mit der „Dritten Verordnung über die Anmeldung des Vermögens von Juden“ mussten schließlich auch persönliche Wertgegenstände wie Kunstwerke, Gold, Silber etc. bei öffentlichen Verkaufsstellen abgegeben werden. Von dieser Regelung ausgenommen waren leidglich die eigenen Eheringe, Zahngold, gebrauchtes Tafelsilber (max. zwei vierteilige Essbestecke pro Person) sowie 200 Gramm andere Silbersachen pro Person. [190] Der geringe Bruchteil des eigentlichen Wertes, den die rechtmäßigen Besitzer für die abgegebenen Gegenstände erhielten [191] , musste wiederum auf Sperrkonten eingezahlt werden, auf die sie nur sehr eingeschränkt und ausschließlich unter vorab einzuholender Genehmigung der zuständigen Behörden Zugriff hatten. [192] In Freiburg war auch nach den Vorgängen nach dem 10. November 1938 das badische Finanz- und Wirtschaftsministerium mit dem zuständigen Oberregierungsrat Stöckinger für die „Arisierungs“- und Liquidierungsvorgänge verantwortlich. [193] Sein Agieren als Kontroll- und Genehmigungsinstanz wird von Brucher-Lembach als zusätzliche Beschleunigung der Arisierungsvorgänge in Freiburg beurteilt. [194]
In diese Entwicklung passt der erzwungene Verkauf des Synagogenareals, das sich die Stadt im März 1939 zu Eigen machte. Dass der Verkauf des Synagogengeländes, auf das die Stadt Freiburg, wie in den voran gegangenen Kapiteln dargelegt, bereits seit einigen Jahrzehnten spekuliert hatte, nun unter den schlechtesten Bedingungen für die Israelitische Gemeinde stattfinden musste, passt wie ein Mosaikstück in den perfiden und dabei doch unkontrollierten, sich gegenseitig bedingenden Prozess der systematischen Entrechtung, Enteignung und Vertreibung der Juden in Freiburg.
4 Der erzwungene Verkauf des Synagogengeländes 1939
4.1. Der Verkaufsvorgang im Einzelnen
Die Vorgänge der „Arisierung“ in Freiburg gelten durch die Arbeiten von Kathrin Clausing und Andrea Brucher-Lembach als relativ gut erforscht sowie dokumentiert. Sie stellen die Schicksale vieler jüdischer Bürger Freiburgs in den Fokus, deren Enteignung die Stufe des materiellen Verlusts auf dem Weg zur völligen Entrechtung, Verfolgung und Ermordung bedeutete. Die Vorgänge rund um den Verkauf und die weitere Verwendung des Platzes der Alten Synagoge sind bislang nur am Rande thematisiert worden. Eine lückenlose Rekonstruktion der Vorgänge ist nur noch teilweise möglich, auch, da Aufzeichnungen aus der damaligen Israelitischen Gemeinde nicht vollständig erhalten sind. [195] Die vorliegenden Kapitel stellen dennoch den Versuch dar, diese Leerstelle zumindest in Teilen zu füllen und dabei neue, relevante Fragen für zukünftige Forschungsvorhaben aufzuwerfen. Dazu sollen zunächst einzelne Schritte nachgezeichnet werden, welche die Vorgehensweise der Stadt im Vorfeld des Ankaufs verdeutlichen. [196]
Der Kaufvertrag zwischen der Stadt Freiburg und der Israelitischen Gemeinde Freiburg über die beiden Grundstücke Nr. 475 (Synagoge) und Nr. 475/1 (Gemeindehaus) wurde am 15. März 1939 geschlossen. Beide Flurstücke sind durch eine Flurstücksteilung im Jahr 1926 entstanden. Das Flurstück 475 wies danach 1.397 Quadratmeter, das Flurstück 475/1 922 Quadratmeter auf. [197]
Wie die oben skizzierten „Arisierungsvorgänge“ zeigen, war die staatlich gelenkte Abwicklung jüdischen Besitzes in Freiburg zu diesem Zeitpunkt bereits fast vollständig abgeschlossen. Auch für die beiden Grundstücke im Besitz der Israelitischen Religionsgemeinschaft gab es bereits einige Jahre vor dem eigentlichen Verkauf konkrete Umbaupläne und Visionen von städtischer Seite aus. Diese Visionen gehen auf die 1920-er Jahre zurück und wurden spätestens mit den Freiburger Ideen für einen Generalbebauungsplan ab 1937 weiter forciert. [198] Heinrich Schwendemann hat die grundsätzlichen Ambitionen der Stadtoberen, Freiburg in der NS-Zeit zu einer monumentalen, dem nationalsozialistischen Ideal entsprechenden Stadt im Südwesten umzubauen in einem Aufsatz aus dem Jahr 2017 dargelegt. [199] Demnach war es Oberbürgermeister Kerber selbst, der sich an dieser Vision berauschte und im Vergleich zu anderen Städten nicht das Nachsehen haben wollte. Die „Systemzeit mit ihren fremden orientalischen Formen und Verjudung und Vernichtung des deutschen artgebundenen Kunst- und Kulturempfindens“ sollte damit ausgemerzt werden. [200] Ein Besuch des Gauleiters Robert Wagner am 1. April 1937 in Freiburg veranlasste Kerber sowie Joseph Schlippe [201] , der seit 1925 Leiter des Freiburger Hochbauamtes war, ein Modell anfertigen zu lassen, das die großzügigen Veränderungen im Rahmen eines Generalbebauungsplans sichtbar machen sollte. Dieses Modell, das erstmals im Herbst 1937 bei der Landesschau der badischen Gemeinden in Karlsruhe ausgestellt wurde, zeigt auch das Areal auf dem zu dieser Zeit noch die Freiburger Synagoge stand. Im Modell ist die Synagoge einem nationalsozialistischen Monumentalbau gewichen, der sich in die bereits bestehenden Bauten von Universität und Theater harmonisch einfügen sollte. [202] Am 1. Dezember 1937 wurde der dazu passende Entwurf für den Generalbebauungsplan vorgelegt, der zeigt, dass die Rotteckstraße zu einer „leistungsfähigen Durchgangsstraße“ mit einem weitläufigen Torgebäude am nördlichen Ende der Straße (heute Fahnenbergplatz) ausgebaut werden sollte. [203] Das damals ebenfalls von Schlippe errichtete Fremdenverkehrsamt (heute Rotteckring 14) wurde bereits 1936 erbaut und könnte als stilistisches Vorbild für die geplanten Arkaden-Häuser entlang dieser Straße gedient haben. [204]
Nur acht Tage nach der Zerstörung der Freiburger Synagoge setzten bei städtischen Behörden euphorische Überlegungen hinsichtlich der künftigen Nutzung des Platzes ein. So schrieb Verkehrsdirektor Denzlinger am 18. November 1938 an OB Kerber, dass er es für den Tourismusstandort Freiburg für notwendig hielte, neue Kongress- und Tagungsräume zu erbauen, die sich „harmonisch in den von der Universität und dem Theater umrahmten Platz einfügen [lassen, Anm. JW].“ [205] Schlippe hatte Kenntnis von diesen Überlegungen und versuchte seinerseits auf Kerber einzuwirken, und ihn von Denzlingers Ideen zu überzeugen. Am 1. Dezember 1938 ließ er ihn schriftlich wissen, dass die Ideen Denzlingers „sehr zu begrüßen“ wären, sofern die Universität keine eigenen Ansprüche an das Gelände zur Erweiterung des Kollegiengebäudes oder die Errichtung eines Studentenhauses anmelde. [206] Was diesen Ideen derzeit jedoch im Weg stehe, seien die damit verbundenen hohen Kosten von geschätzt einer halben Million Reichsmark. [207] Wahrscheinlich war dies mit ein Grund dafür, weshalb Kerber am 25.3.1939 schließlich entschied, das Gelände der ehemaligen Synagoge „grundsätzlich für die Bedürfnisse der Universität“ vorzubehalten. [208] Es scheint auch kein Zufall gewesen zu sein, dass Kerber sich erst nach dem offiziellen Ankauf des Geländes am 15. März 1939 dezidiert zur weiteren Nutzung des Geländes äußerte. Denn auch wenn die Israelitische Gemeinde nach der Verordnung vom 3. Dezember 1938 nicht mehr frei über ihre Grundstücke verfügen durfte, war sie doch bis zum offiziellen Verkauf nach wie vor die rechtliche Eigentümerin. Diese Vorgänge zeigen, mit welcher Selbstverständlichkeit die Verantwortlichen in der Stadt über die Zukunft des Platzes bestimmten. Rechtliche oder moralische Bedenken klingen in keinem der Schriftwechsel an.
Auch wenn diese Überlegungen sehr wahrscheinlich hinter verschlossenen Türen abgestimmt wurden, gab es schon vor dem Frühjahr 1938 Verhandlungen mit der Israelitischen Gemeinde über den Ankauf des Geländes. Da auch in diesem Fall keine Akten aus der Israelitischen Gemeinde mehr existieren, wird der Vorgang erneut nur aus Sicht der städtischen Unterlagen nachgezeichnet werden können.
Bereits im Dezember 1938, wenige Tage nach dem Erlass der „Verordnung über den Einsatz des jüdischen Vermögens“ meldete Oberbürgermeister Kerber beim badischen Finanz- und Wirtschaftsminister persönlich Interesse an jüdischen Grundstücken an. Er schreibt am 13. Dezember 1938:
„In der Stadt Freiburg befinden sich eine Reihe von Grundstücken, insbesondere Gebäude, in jüdischen Besitz, in welchen die Stadt zwecks Erfüllung künftiger öffentlicher Aufgaben ein starkes Interesse hat. Aus finanziellen Gründen kann die Stadt der sofortigen Erwerbung all’ dieser Gebäude selbstverständlich nicht näher treten, jedoch sollte es ermöglicht werden, im Falle der Veräusserung des einen oder anderen Grundstücks Stellung zu der Frage zu nehmen, ob nicht unter dem Druck der Verhältnisse die Stadt das Eigentum für sich zu sichern hat. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass sowohl der jüdische Besitzer als auch arische Kaufinteressenten von der Kaufabsicht der Stadt Kenntnis haben und versuchen, diese Absicht zu durchkreuzen und einen Kaufabschluss zu tätigen. Das gemäss § 8 Absatz 1 der Verordnung vom 3. Dezember 1938 die Verfügung über die Grundstücke durch Juden zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung bedarf, würde ich es im öffentlichen Interesse begrüssen, wenn bei einem etwaigen Verkauf nachstehend genannter Grundstücke vor Erteilung der Genehmigung der Stadt Gelegenheit gegeben würde, sich darüber zu äussern, ob sie an dem betreffenden Grundstück ein solches Interesse hat, dass sie selbst als Käufer auftritt und daher die Genehmigung zu dem vorliegenden Kaufvertrag zu verweigern wäre.“ [209]
Es folgt eine Auflistung von insgesamt 14 Grundstücken, darunter auch „Werthmannplatz 1, Werthmannplatz 3, Eigentümer Israel. Gemeinde“. Eine Antwort des badischen Finanz- und Wirtschaftsministers geht noch im Dezember in Freiburg ein. Darin heißt es, dass dem „obigen Ersuchen“ entsprochen werden soll. [210] Die Stadt hatte sich auf diese Weise ein „Vorkaufsrecht“ an jüdischen Grundstücken in Freiburg gesichert. Die Sorge der Stadt zielte – abgesehen von der derzeitigen finanziellen Lage – dabei nicht auf die rechtliche oder moralische Frage ab, ob und wie diese Grundstücke überhaupt erworben werden dürften, sondern wie man sich gegen potentielle weitere Kaufinteresssenten durchzusetzen vermochte. Unklar war indes, wer die von nun an zuständigen Ansprechpartner auf jüdischer Seite waren, wie aus diesem Schreiben des Liegenschaftsamts an Abteilung 3 des Oberbürgermeisteramts vom 9. Januar 1939 hervorgeht:
„Die von uns bereits aufgenommenen Verhandlungen wegen Erwerbs der Synagoge und des Betsaalgebäudes (Anwesen Werthmannplatz 1 und 3) wurden durch den Brand der Synagoge und die Internierung der Juden unterbrochen. Es ist z. Zt. völlig ungeklärt, wer nunmehr Eigentümer dieser beiden Grundstücke ist und wer die Vertretungsbefugnis hat. Wir bitten daher bei dem badischen Finanz- und Wirtschaftsminister anfragen zu wollen, ob und mit wem Erwerbsverhandlungen heute überhaupt geführt werden können. Der Herr Minister wolle insbesondere auch darauf aufmerksam gemacht werden, daß die beiden Grundstücke aus Gründen des öffentlichen Interesses nur an die Stadt verkauft werden dürfen .“ [211]
Das badische Finanz- und Wirtschaftsministerium schreibt am 24. Januar an das Oberbürgermeisteramt, dass der Oberrat der Israeliten in Karlsruhe verfügungsberechtigt sei und dass die Wünsche der Stadt hinsichtlich des Ankaufs der beiden Grundstücke berücksichtigt werden würden. [212] Obwohl zu dieser Zeit – auch hinsichtlich der erst kürzlich veröffentlichten Verordnung vom 3. Dezember 1938 – nach wie vor die Israelitische Gemeinde Eigentümerin der Grundstücke war bzw. der Oberrat der Israeliten als übergeordnete Behörde fungierte, schien es nach den Verhaftungen in der Pogromnacht und den anschließenden zahlreichen neuen Verordnungen bei den lokalen Behörden zu Unsicherheiten ob dieser Zuständigkeiten gekommen zu sein.
Unter welchen Umständen es im unmittelbaren Vorfeld zum letztlichen Kaufabschluss am 15. März 1939 gekommen ist, kann heute nicht mehr eindeutig rekonstruiert werden. [213] Die Akten der Israelitischen Gemeinde, die darüber hätten Aufschluss geben können, sind heute nicht mehr vorhanden. So muss sich die Darstellung der einzelnen Schritte bis zum Inkrafttreten des Kaufvertrags auf die vorhandenen städtischen Akten beschränken.
Fest steht, dass sich Julius Bloch, der Vorsteher des Synagogenrats Freiburg, sowie Erwin Hiegert [214] als Bevollmächtigter der Stadt Freiburg, am 15. März 1939 im Freiburger Grundbuchamt eingefunden haben und der Vertrag dort unterzeichnet wurde. Im Vorfeld schon hatte der Oberrat der Israeliten in Karlsruhe dem Vertragsvorschlag zugestimmt. [215] Laut Vertragstext wurden die beiden Grundstücke Nr. 475 (Synagogengflurstück) und Nr. 475/1 (Gemeindehausflurstück) zu insgesamt 67.000 Reichsmark an die Stadt Freiburg verkauft. Unter § 3 des Vertrags wurde festgelegt, dass die auf den beiden Grundstücken befindlichen Gebäude oder Gebäudereste „im derzeitigen Zustande“ an die Stadt übergehen. Außerdem sollte die Israelitische Gemeinde für die polizeilich angeordneten und von der Stadt übernommenen Abbruchkosten für die Synagogenreste über 5.602 Reichsmark aufkommen. Dieser Betrag sollte vom Kaufpreis abgezogen werden. Unter § 5 des Kaufvertrags wurde ferner bestimmt, dass der Gemeinde ein Mietrecht für das Gemeindehaus, das nun ebenfalls an die Stadt übergegangen war, zugesprochen wird. Gegen eine „als Miete anzusehende Anerkenntnisgebühr“ von jährlich 600 Reichsmark sollte die Gemeinde dort weiter Gottesdienste und Unterricht für die jüdischen Schüler abhalten dürfen. [216] Allerdings sollte das Gemeindehaus dazu zunächst auf Kosten der Israelitischen Gemeinde instandgesetzt und die in der Pogromnacht entstandenen Schäden beseitigt werden. Das Mietrecht wurde übergangsweise eingerichtet und konnte durch Entscheidung des Oberbürgermeisters jederzeit gekündigt werden. [217] Um die Wirksamkeit des Vertrages zu erreichen, musste dieser noch vom badischen Finanz- und Wirtschaftsminister genehmigt werden. Diese Genehmigung erfolgte am 22. Mai 1939. Hierin wird noch darauf verwiesen, dass der zu zahlende Kaufpreis „auf ein mit Genehmigung der Devisenstelle G Karlsruhe, Redtenbacherstr. 9 zu errichtendes Sperrkonto zu zahlen“ sei. [218]
Der Oberfinanzpräsident in Karlsruhe (Devisenstelle) gab am 23. Juni 1939 dazu folgende Auskünfte:
„[...] Zur Durchführung dieses Grundstücksverkaufes ist devisenrechtliche Genehmigung nicht erforderlich, da es sich um ein Rechtsgeschäft zwischen Inländern handelt.
Ich mache dagegen die Auflage, dass der Kaufpreis in Höhe von 67.000 RM nach Abzug der in § 4 des Vertrages genannten Gegenforderungen auf das bei der Deutschen Bank, Filiale Freiburg i.Br. geführte Sperrkonto nach § 59 des Dev.Ges. der Israelit. Gemeinde Freiburg i.Br. eingezahlt wird. Die Errichtung dieses Kontos ist meiner Überwachungsabteilung, Devisenstelle „S“, Karlsruhe, Moltkestr. 31b, zu bestätigen. Bei der gleichen Stelle sind Anträge auf Freigabe von Beträgen aus diesem Konto einzureichen.“ [219]
Am 5. Juli 1939 folgte ein Schreiben des Synagogenrats Freiburg an das Oberbürgermeisteramt, mit der Bitte um Auszahlung der Restkaufsumme an die Israelitische Gemeinde:
„ Der Herr Oberfinanzpräsident Baden (Devisenstelle) in Karlsruhe hat mit Schreiben M 179203 vom 23.6.1939 an Sie den obigen Grundstücksverkauf genehmigt unter der Bedingung, dass der Kaufpreis nach Abzug der in § 4 des Vertrags genannten Gegenforderungen auf ein bei der Deutschen Bank, Filiale Freiburg, durch uns zu errichtendes Sperrkonto eingezahlt wird.
Wir bitten nunmehr um Erledigung der Angelegenheit und zwar
- um Überweisung des Betrags der Hypothek in Höhe von RM 3.2000 RM an den Oberrat der Israeliten in Karlsruhe, Kriegsstr. 154
- um Überweisung des Restkaufpreises abzüglich der in § 4 des Kaufvertrags genannten Gegenforderungen, an die Deutsche Bank, Filiale Freiburg i/B., zu Gunsten der Israel. Gemeindeverrechnung,
Über die in Abzug gebrachten Gemeindesteuern erbitten wir s. Zt. Aufstellung.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Julius Bloch “ [220]
Das Liegenschaftsamt bestätigte am 12. Juli 1939 die korrekte Löschbewilligung für die eigetragenen Hypotheken und bat um Zahlungsanweisung für den Kaufpreis. [221]
Der Kaufpreis wurde laut eines Schreibens des Synagogenrats vom 23. August 1939 auf das Konto der Israelitischen Gemeinde überwiesen. Paradoxerweise war jedoch der volle Kaufpreis überwiesen worden, ohne die abzugehenden Kosten für den Abbruch der Synagoge. Hierauf macht Julius Bloch die Stadt aufmerksam:
„Wir bestätigen den Eingang der auf Sperrkonto bei der Deutschen Bank, Filiale Freiburg überwiesenen RM 67.000.-,
Kaufpreis für Erwerb der Grundstücke Lgb. Nr. 475 & 475/1. Wir haben jedoch hierzu zu bemerken, dass die Zahlung des vollen Kaufpreises durch Sie auf einem Irrtum beruht, da lt. § 4 des Kaufvertrags in Abzug zu bringen sind:
- RM 5602,- für den Abbruch der abgebrannten Synagoge
- Die für die Grundstücke noch rückständigen öffentlichen Abgaben.
Damit wir nun bei der Devisenstelle in Karlsruhe um Freigabe dieser Beträge zur Rückzahlung an Sie nachsuchen können, bitten wir, uns umgehend zugehen zu lassen:
- ein Anforderungsschreiben für die RM 5602,- Abbruchkosten.
- Eine Aufstellung über die durch uns noch zu zahlenden öffentlichen Abgaben, soweit noch rückständig.
Wir werden dann nach Eingang der Devisenstelle die betr. Beträge an Ihre Kasse wieder zurücküberweisen.“ [222]
Laut der letzten, schriftlich vorhandenen Aufzeichnung dieses Prozesses – es stammt vom Kassenamt der Stadt Freiburg – wurden die Kosten für den Abbruch sowie die rückständigen öffentlichen Lasten des Grundstücks von der Israelitischen Gemeinde an die Stadt Freiburg zurücküberwiesen. Das Schreiben endet mit der Bemerkung, dass der Synagogenrat nun tatsächlich nur den in § 4 des Vertrags zustehenden Kaufpreis erhalten habe und die Angelegenheit damit erledigt sein dürfte. [223] Welchen Weg diese Restkaufsumme im weiteren Verlauf der systematischen Enteignung genommen haben könnte, wird Gegenstand des folgenden Kapitels sein. Wie hoch der Druck war, der auf die Israelitische Gemeinde von Seiten der Stadt ausgeübt wurde, ist anhand des vorhandenen Quellenmaterials schwer zu beurteilen. Fest steht jedoch, dass die Freiburger Vorgänge deutlich früher einsetzten, als dies von Reichsseite aus festgelegt war. Das Reichsamt für Kirchenangelegenheiten in Berlin veröffentlichte am 24. März 1939 (!) „Richtlinien“ für den Umgang der Kommunen mit den Resten niedergebrannter Synagogen und den Grundstücken, auf denen diese standen. Im Schreiben heißt es, dass von einer Enteignung abgesehen werden sollte, um nicht den Eindruck zu bestärken, man würde den Juden nun „ihre religiöse Betätigung unmöglich [...] machen“. Ferner sollte den jüdischen Gemeinden auferlegt werden, für die Abtragung der Gebäudereste aufzukommen. Falls die Gemeinden dazu nicht in der Lage seien, sollte das Grundstück Interessenten – vornehmlich den Kommunen – zum Kauf angeboten werden. Falls sich dabei kein Interessent fände, würde das Gelände zwangsveräußert werden und der Kaufinteressent hätte für den Abbruch der Synagogenreste aufzukommen. [224] Diesen Richtlinien hat die Stadt Freiburg ganz offensichtlich vorgegriffen und den zwangsweisen Verkauf auf der Grundlage der Verordnung vom 3. Dezember 1938 selbständig und ohne Kompromisse nach ihren eigenen Bedürfnissen sowie zu Lasten der Israeltischen Gemeinde durchgeführt. Der Kaufpreis für die beiden Grundstücke orientierte sich an dem am 1. Januar 1935 festgelegten Einheitswert für diese Grundstücke und wurde danach berechnet. Dies wird zumindest in den städtischen Akten so dargelegt. Demnach belief sich der Einheitswert des Grundstücks auf 46.300 RM. [225]
Die hehren Pläne hinsichtlich der Errichtung von Kongressräumen oder einem Neubau durch die Universität wurden vorerst zurückgestellt. Anstatt dessen sollte auf den eingeebneten Resten der Synagoge ein Parkplatz errichtet werden, der die Erinnerung an die Synagoge schnellst möglich tilgen sollte. Auch dieser Plan wurde jedoch nicht umgesetzt. [226] Erst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde das Areal schließlich einer provisorischen Nutzung als Baugelände für sogenannte Behelfsläden zugeführt sowie als Parkplatz genutzt. [227]
4.2 Der Verbleib der Kaufsumme von 1939 und die „Verwertung“ jüdischen Eigentums
Eine Frage, die in der Forschung bislang selten gestellt und noch nicht hinreichend beantwortet werden konnte, ist die nach dem Verbleib der Kaufsumme für das Synagogengelände. [228] Jene Frage ist zuvorderst und grundsätzlich mit der „Verwertung” des jüdischen Eigentums verknüpft, also mit dem Vorgang der Beschlagnahmung jüdischen Vermögens und dessen Einspeisung in die Reichskasse oder andere Organe des nationalsozialistischen Regimes. [229] Die schwierige Quellenlage macht es auch heute nicht mehr möglich, die Wege, die das Geld genommen haben mag, detailliert und lückenlos nachzuzeichnen. Im Rahmen der hier dokumentierten Recherche konnten allerdings Quellen gesichtet und ausgewertet werden, die zumindest einzelne Wege ausschließen sowie einige wahrscheinlicher erscheinen lassen. Diese seien im Folgenden mit einem vergleichsweisen Blick auf den allgemeinen Prozess der „Verwertung” jüdischen Eigentums beschrieben.
Auch bei der sogenannten Verwertung jüdischen Besitzes ist in Freiburg im Vergleich zu anderen Städten im Deutschen Reich ein Sonderweg zu beobachten. Dieser Sonderweg steht in engem Zusammenhang mit der frühen Deportation der Freiburger Juden in das französische Lager Gurs. Bereits am 22. Oktober 1940 nämlich wurden 375 [230] von den ca. noch 600 in Freiburg lebenden Juden nach Gurs deportiert. [231] Gauleiter Robert Wagner ordnete gemeinsam mit Josef Bürckel, dem Gauleiter für die „Saarpfalz“, die Deportation der Juden aus Baden, dem Saarland und der Pfalz an – noch ein Jahr vor dem Beginn der reichsweiten Massendeportationen. [232] Nach dem Sieg über französische Truppen am 2. August 1940 und der anschließenden Eingliederung Elsass-Lothringens sprach Hitler den beiden Gauleitern im Südwesten weitreichende Vollmachten bei der „Eindeutschung“ der gewonnen Gebiete zu. Ihre Aufgabe sahen sie nun auch darin, die unter ihrer Verwaltung stehenden Gebiete „judenfrei“ zu machen und begriffen dies als einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Zwangsaussiedlung der jüdischen Bevölkerung. [233] Obwohl diese Entscheidung noch nicht das Äußerste, also den systematischen, massenhaften Mord der Menschen zum Ziel hatte, nahmen sie mit den schon damals unter schlimmsten Bedingungen stattfindenden Deportationen das Leid und den Tod der Deportierten in Kauf.
Die Ankündigung, dass die Deportation erfolgen wird, erhielten die Betroffenen erst wenige Stunden vor dem Abtransport am frühen Morgen des 22. Oktober, dem Tag des jüdischen Laubhüttenfestes. Es war ihnen lediglich gestattet, wenige Habseligkeiten sowie 100 RM in bar mit sich zu führen. [234] Unter den Deportierten waren viele ältere Menschen, die eigentlich auf umfassende medizinische Betreuung angewiesen waren. [235] Auch Julius Bloch, der Vorsitzende des Freiburger Synagogenrats befand sich unter den Deportierten. [236] Was mit dem zurückgelassenen Vermögen der Deportierten geschehen sollte, war zu diesem Zeitpunkt noch vollkommen unklar. Kurz vor dem Abtransport nach Südfrankreich mussten die Menschen noch eine rasch erstellte Erklärung unterzeichnen, in der sie zustimmten, ihr gesamtes Vermögen nach der Deportation an die „Reichsvereinigung der Juden“ abzutreten. [237] Dies hatten örtliche Gestapo-Behörden in direkter Kommunikation mit einzelnen Bezirksstellen der „Reichsvereinigung der Juden“ angeordnet, ohne die Berliner Zentrale der „Reichsvereinigung“ darüber zu informieren. [238]
Nachdem die aus Freiburg Deportierten ihres zurückgelassenen Hab und Guts auf einem schein-legalen Weg unmittelbar vor dem Abtransport beraubt worden waren, verkündete Gauleiter Wagner nur einen Tag nach der Deportation eine „Anordnung über die Verwaltung und Verwertung des jüdischen Vermögens in Baden“. [239] Hierhin heißt es:
„I. Das gesamte Vermögen der aus Baden ausgewiesenen Juden wird beschlagnahmt und dem Land Baden für verfallen erklärt.
- Die Verwaltung und „Verwertung” dieses Vermögens obliegt dem Generalbevollmächtigten für das jüdische Vermögen in Baden, der von dem Minister des Innern in Karlsruhe ernannt wird und dessen Dienstaufsicht untersteht. [...]
Karlsruhe, den 23. Oktober 1940
Gez. Robert Wagner, Gauleiter und Reichsstatthalter“ [240]
Bereits anhand dieses Schreibens wird deutlich, dass die Vorgänge und das Ziel der „Verwertung” des jüdischen Vermögens alles andere als klar geregelt waren, es vielmehr zu einem Kompetenz- und Einflussgerangel zwischen den beteiligten Behörden gekommen sein musste. So widerspricht Wagners Anordnung der bereits durchgeführten Praxis vom 22. Oktober, nach der das Vermögen nicht dem Land Baden (wie von Wagner gefordert) sondern der „Reichsvereinigung“ als einem Organ des Reichssicherheitshauptamts und der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) obliegen sollte. [241] Das zurückgelassene jüdische Vermögen, das für Baden auf 60 Millionen Reichsmark beziffert wurde, weckte in den mittelbar beteiligten Behörden offenbar große Begehrlichkeiten. [242] In Konkurrenz standen dabei das badische Finanz- und Wirtschaftsministerium, das badische Innenministerium, die Gestapo, die Gauleiter sowie die lokalen Unterbehörden und ausführenden Organe der Ministerien. [243]
Auf die Anordnung Wagners vom 23. Oktober wurde nur sechs Tage später, am 29. Oktober 1940, der Jurist Carl Dornes vom badischen Innenminister zum „Generalbevollmächtigten für das jüdische Vermögen in Baden“ berufen. [244] Dornes ordnete die Einrichtung von speziellen Abteilungen für jüdisches Vermögen in den ihm unterstellten Landratsämtern an. In den Städten Freiburg, Heidelberg, Pforzheim, Mannheim und Baden-Baden übernahmen die Polizeidirektionen als ihm unterstellte ausführende Behörden diese Funktion. [245] Über die Einrichtung dieser Abteilungen sollte in der Öffentlichkeit Stillschweigen bewahrt werden, um keine öffentliche Unruhe auszulösen und bei anderen Behörden ob der zu verwaltenden Höhe der Summe keine weiteren Begehrlichkeiten zu wecken. [246] Am 6. November 1940, nur wenige Tage nach seiner Berufung zum Generalbevollmächtigen für die Verwaltung und „Verwertung” jüdischen Vermögens, informierte Dornes die ihm unterstellte Polizeidirektion in Freiburg, dass er bei der Gestapo um „baldmögliche Klarstellung über das weitere Schicksal des Oberrats der Israeliten und der Bad. Jüdischen Kultusvereinigungen“ ersuche. Von einer „Verwertung” von Vermögensstücken dieser Organisationen sei einstweilen abzusehen. [247]
Doch waren die Zuständigkeiten damit noch immer nicht final geklärt: Am 9. November 1940 wies Heinrich Himmler als Reichsführer SS und Vorgesetzter Heydrichs, der das RSHA leitete, in einer vierseitigen Weisung seinerseits die „Sicherstellung aller von den aus der Pfalz und Baden evakuierten Juden zurückgelassenen Vermögenswerte“ an. [248] Darin rechtfertigte er auch den Schritt, alle zu deportierenden Juden eine „Generalvollmacht“ über die „Verwertung” ihres Vermögens durch die Reichsvereinigung unterschrieben haben zu lassen, mit einer dadurch vermeintlich einhergehenden „Vereinfachung des Geschäftsverkehrs“. [249]
Die Verwaltung und „Verwertung” des jüdischen Vermögens sollte dabei nach wie vor beim Generalbevollmächtigten für das jüdische Vermögen, Carl Dornes, liegen. Gauleiter Wagner nahm seine Anordnung vom 23. Oktober 1940 daraufhin zurück und erklärte, dass die „Abwicklung des jüdischen Vermögens [...] künftig auf Grund der [...] Verfügung des Reichsführers SS und Chefs der deutschen Polizei vom 9. November 1940“ zu realisieren sei. [250] Die Umsetzung dieser Anordnung beinhaltete, dass Hypotheken, Aktien und Wertpapiere treuhänderisch verwaltet werden sollten. Bekleidung, sofern sie nicht neuwertig war, sollte der „Reichsvereinigung“ zum Schätzwert angeboten werden. Wohnungen sollten ausgeräumt, das Inventar öffentlich versteigert und die Wohnungen im Anschluss schnellstmöglich weitervermietet werden. Grundstücke durften – und darauf verwies die Verordnung ganz explizit – hingegen nicht veräußert, sondern sollten zunächst nur erfasst und verwaltet werden. [251]
Am 12. Dezember 1940 schließlich ließ Dornes den ihm unterstellten Behörden folgende Weisung zukommen:
„Das Reichssicherheitshauptamt Berlin hat entschieden, daß die jüdischen Kultusvereinigungen in Baden als die örtlichen Zweigstellen der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland nicht von den am 22.10.1940 in Baden durchgeführten Maßnahmen betroffen werden, sodaß dem Oberrat der Israeliten in Baden die ungehinderte Abwicklung aller Vermögensfragen der jüdischen Kultuseinrichtungen in Baden zu gestatten ist. Etwa ergangene Sicherungsanordnungen oder andere Verfügungsbeschränkungen sind infolgedessen rückgängig zu machen. Die Geheime Staatspolizei – Staatspolizeileitstelle Karlsruhe – wird den Juden Karl Israel Eisemann mit der Abwicklung aller Vermögensfragen der Jüdischen Kultusvereinigung in Baden beauftragen. Es wird ihm dabei eröffnet werden, daß es nicht seine Aufgabe ist, die früheren Kultusvereinigungen wieder aufzubauen und neu entstehen zu lassen, sondern daß er sich nur mit der Abwicklung der Vermögensfragen zu befassen hat.
gez. Dornes“ [252]
Am 22. Juni 1941 wies Dornes die ihm unterstellten Landratsämter und Polizeidirektionen in Baden mit dem „Runderlass Nr. 49“ darauf hin, dass „[...] es Zweck und Aufgabe der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland [sei], die Auswanderung der Juden aus Deutschland zu fördern, nicht aber Aufgabe der Verwaltung des beschlagnahmten jüd. Vermögens.“ [253] Im Vorfeld scheint es bei den beteiligten Behörden offenbar zu Unklarheiten ob dieser Zuständigkeiten gekommen zu sein. In mehreren Rundbriefen und Schreiben macht Dornes im weiteren Verlauf deutlich, dass er allein für die „Verwertung” des jüdischen Vermögens der Deportierten, inklusive aller Bankkonten zuständig sei. Eine Ausnahme bilde das Vermögen der Israelischen Gemeinden, der Wohlfahrts- und sämtlicher anderer jüdischer Organisationen. Für die „Verwertung” dieser Vermögensanteile sei die „Reichsvereinigung“ in Karlsruhe, mit ihrem eingesetzten Verwalter, Karl Eisemann, zuständig. [254]
Die „Verwertung” jüdischen Privatbesitzes nach dem 22. Oktober 1940
Wie ist die Erfassung und „Verwertung” des jüdischen Privatbesitzes aber nun im Einzelnen vor sich gegangen? Die Erlöse aus den öffentlichen Versteigerungen wurden von den zuständigen Polizeidienststellen und den von ihnen beauftragten Gerichtsvollziehern akribisch erfasst. So legte die zuständige Polizeidirektion Listen über die versteigerten Gegenstände sowie die daraus erzielten Beträge an. Später wurden diese Beträge auf das Sammelkonto „Jüdisches Vermögen“ der Polizeidirektion bei der Sparkasse Freiburg eingezahlt. [255]
Für jede deportierte Person wurde eine gesonderte Kontokarte angelegt, auf der sämtliche Geldeingänge (zum Beispiel Mietzinsen von Mietern) sowie Ausgaben (zum Beispiel für Strom, Gas, etc.) vermerkt wurden. Für Freiburg sind noch zahlreiche dieser Kontokarten im Staatsarchiv erhalten. [256] Die eingegangenen Beträge wurden jeweils abzüglich zehn Prozent auf ein Verwaltungssammelkonto (Konto A) transferiert. Die zehn Prozent wurden auf ein zweites „Generalunkostenkonto“ überwiesen, das mitunter dazu genutzt wurde, um die Kosten für die Deportationen und die damit verbundene Verwaltung zu decken. [257] Diese Maßnahmen sind von der Vorstellung geprägt, dass die rechtmäßigen Besitzer der Vermögenswerte zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr auf diese zurückgreifen würden. [258]
Die öffentlichen Versteigerungen von jüdischem Besitz stießen im gesamten Reich, so auch in Freiburg, auf ein breites Interesse in der Bevölkerung. Die öffentlich angekündigten Versteigerungen fanden entweder in Pfandlokalen oder in den Wohnungen der Deportierten statt, wobei die wertvollsten Gegenstände vielerorts schon vor den Versteigerungen verschwanden oder unter der Hand an Interessierte verkauft wurden. [259] Zwischen Ende November 1940 und März 1941 wurde nahezu täglich Hausrat und Besitz von deportierten Juden in Freiburg versteigert. [260] Die Erlöse aus diesen Versteigerungen erfasste ein anwesender Gerichtsvollzieher sehr genau und überwies der örtlichen Polizeidienststelle im Anschluss den eingebrachten Gesamtbetrag. Obwohl die meisten Gegenstände weit unter ihrem eigentlichen Wert verkauft wurden, erzielte die „Abteilung zur Verwaltung und Verwertung des jüdischen Vermögens“ im Landkreis Freiburg von Ende November 1940 bis Ende März 1941 aus den Versteigerungen jüdischen Hausrats eine beachtliche Summer von über 300.000 RM. [261] Die Frage nach Moral und Anstand gegenüber den Menschen, deren Besitz hier veräußert wurde, stellte sich an dieser Stelle offenbar nicht mehr. Doch waren diese Vorgänge auch aus juristischer Sicht mehr als bedenklich. Die Abtretung des gesamten Vermögens durch ein rasch unterzeichnetes Schriftstück kurz vor dem Abtransport nach Frankreich war alles andere als juristisch legitimiert. [262] Noch dazu galten die abgetretenen Vermögenswerte durch den Erlass Himmlers im November 1940 zumindest offiziell lediglich als „sichergestellt“. [263] Es ist aus Sicht der NS-Behörden deshalb nicht verwunderlich, dass eine alternative Vorgehensweise gefunden werden musste, schon alleine, um die ab 1941 durchgeführten Massendeportationen und das beschlagnahmte Eigentum der Deportierten fiskalisch zu verwerten. [264] Am 4. November 1941 erließ das Reichsfinanzministerium deshalb neue Regelungen zum Umgang mit dem eingezogenen Eigentum und setzte sich damit über die bis dahin gültigen Bestimmungen des Reichsinnenministeriums hinweg. [265] Nach diesen Bestimmungen sollten von nun an die örtlichen Oberfinanzdirektionen für den Einzug und die „Verwertung” des jüdischen Vermögens zuständig sein. [266] Der nun so benannte „Vermögensverfall“ war damit keine individuelle Angelegenheit mehr, mit dem sich die zuständigen Behörden teilweise in langwierigen Prozessen auseinandersetzen mussten, sondern Teil einer kollektiven Enteignung, die auf Grundlage der erstellten Deportationslisten erfolgen konnte. [267] Mit der elften Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 25. November 1941 schließlich wurden die Regelungen noch einmal insofern verschärft, als dass Juden beim Verlassen des Reichsgebiets automatisch ihre Staatsbürgerschaft verloren. Damit ging auch der Verlust des gesamten Vermögens zugunsten des Reiches einher. Lag der Zielort der Deportation noch innerhalb des Reichsgebiets (wie z.B. beim Lager Theresienstadt, das sich im Protektorat Böhmen und Mähren befand), wurden die dort Inhaftierten kurzerhand zu „Reichsfeinden“ deklariert, was auf der Grundlage der Gesetze von 1933 ebenfalls zum sofortigen Verfall ihres Besitzes zugunsten des Reiches zur Folge hatte. [268]
In Baden war mit den Gesetzesänderungen vom November 1941 nun nicht mehr Carl Dornes als Generalbevollmächtigter für das jüdische Vermögen für dessen Verwaltung und „Verwertung” zuständig, sondern die Oberfinanzpräsidien sowie die untergeordneten, lokalen Finanzämter. [269] In Freiburg ging die Zuständigkeit zum 1. Februar 1942 damit von der örtlichen Polizeidirektion an das Finanzamt über. [270] Die Verwaltungspraxis änderte sich mit den neuen Zuständigkeiten kaum. So wurden in Freiburg mit den gleichen Kontokarten und „buchmäßigen Anderkonten“ weitergearbeitete wie vor dem Erlass vom November 1941. [271]
Die „Verwertung” des jüdischen Gemeindevermögens in Freiburg
Diese reichsweiten sowie auf Baden bezogenen allgemeinen Vorgänge und Erlässe hinsichtlich der Verwaltung und „Verwertung“ des jüdischen Vermögens sind essentiell für die Einordnung der Geschehnisse rund um die „Arisierung“ und die „Verwertung” des jüdischen Gemeindevermögens in Freiburg. Für die Vermögenswerte der Israelitischen Kultusgemeinde war wie oben beschrieben ein anderes Vorgehen vorgesehen, als es für die Verwaltung und „Verwertung” von jüdischem Privatbesitz bestimmt war. Dennoch wurde die Israelitische Gemeinde behördlich offenbar als „deportierte Person“ behandelt, auf die ein ähnliches Rechtsverständnis wie bei natürlichen Personen angewandt wurde. [272]
Nur zwei Tage nachdem Dornes die Freiburger Polizeidirektion darüber informiert hatte, dass von der „Verwertung” von Vermögensstücken aus der Israelitischen Gemeinde vorerst abzusehen sei, kamen von städtischer Seite Begehrlichkeiten hinsichtlich der Verwendung des Gemeindehauses auf dem Nachbargrundstück der Synagogengemeinde auf. In einem Schreiben des Liegenschaftsamts an die Polizeidirektion wurde um „möglichst rasche Freigabe des Hauses“ gebeten, da dort ein heilpädagogischer Hort untergebracht werden sollte, schließlich käme eine Benutzung durch die Israelitische Gemeinde nun nicht mehr infrage. [273] Das Anliegen des Liegenschaftsamtes bezog sich auf die Möbel und Gegenstände, die sich noch im Haus der Israelitischen Gemeinde befanden, da das Haus inklusive des Flustücks bereits durch den Kaufvertrag von 1939 in den Besitz der Stadt übergegangen war. Um möglichst schnell über die Räume verfügen zu können, erklärte sich die Stadt daraufhin bereit, die aufgeführten Gegenstände zu einem vorab von einem Beamten festgestellten Preis zu übernehmen. [274] Dass die Gegenstände, wie in einem erneuten Schreiben der städtischen Abteilung für Jüdisches Vermögen an das städtische Hochbauamt vom 14. November 1940 „vorerst nur leihweise“ überlassen werden durften, spielte offenbar keine große Rolle. So wurde dann – dies belegen die noch vorhandenen Akten – sehr rasch mit der Auflistung und Schätzung der noch vorhandenen Gegenstände im Gemeindehaus der Israelitischen Gemeinde begonnen. Dabei wurde ein Teil am 23. November 1940 durch einen Gerichtsvollzieher versteigert und der dabei erzielte Betrag von 858,35 RM an die städtische Sparkasse Freiburg überwiesen, zur Gutschrift auf das Girokonto Nr. 29.25 der Polizeidirektion Freiburg. [275] Am 26. November 1940 quittierte das Hochbauamt Freiburg den Erhalt von zahlreichen Einrichtungsgegenständen aus dem Gemeindehaus, die einen Schätzwert von 651 RM aufwiesen. Übergeben wurden die Gegenstände ebenfalls von der Polizeidirektion. [276] Beide Beträge, sowohl für die versteigerten Gegenstände als auch für die an die Stadt übergebenen Gegenstände, sind in einem Kontoblatt, das von der Polizeidirektion für die Israelitische Gemeinde angelegt worden war, vermerkt. Dabei handelte es sich um eines der Kontoblätter, die für alle deportierten Juden angelegt worden waren, um sämtliche Aus- und Einnahmen, z.B. Mieten, Nebenkosten, Vermögenabgaben, Erlöse von Versteigerungen des Hausrats etc. dokumentieren und verwalten zu können. Obwohl das Kontoblatt der Israelitischen Gemeinde bereits mit der letzten Auszahlung über 529,35 RM an die „Reichsvereinigung der Juden“ als „abgeschlossen“ betitelt wird, wurde noch bis zum 30. Juni 1944 akribisch vermerkt, dass keinerlei Kontobewegungen mehr stattgefunden haben. [277] In einer Auflistung der Kontostände aller aus Freiburg im Oktober 1940 evakuierten Juden vom 31. Januar 1942 wird unter Lfd.No. 155 das Vermögen der Synagogen-Gemeinde mit „-,--,“, also Null, angegeben. [278] Dies entspricht den Aufzeichnungen aus dem Kontoblatt der Synagogengemeinde und legt den Schluss nahe, dass das Vermögen der Israelitischen Gemeinde, zu dem schließlich auch der Kaufpreis für die beiden Flurstücke am Werthmannplatz gehörte, bereits zwischen September 1939 und Ende November 1940 nicht mehr durch die örtliche Polizeidirektion, Abteilung jüdisches Vermögen, verwaltet und später verwertet wurde, sondern auf anderem Wege der Reichskasse zugeführt wurde. Die Polizeidirektion in Freiburg war, wie bereits beschrieben, bis 1941 dem Generalbevollmächtigten für das jüdische Vermögen in Baden, Carl Dornes, unterstellt. Dieser führte rege Korrespondenzen mit dem Bezirksstellenleiter der „Reichsvereinigung“ in Baden, Karl Eisemann. [279] Karl Eisemann wandte sich im März 1941 dennoch direkt an die Polizeidirektion Freiburg, mit der Bitte, die Summe für die ersteigerten Gegenstände aus dem Freiburger Gemeindehaus auf das Konto der „Reichsvereinigung“ zu überweisen. Als Grund dafür gab er an, dass Reichsvereinigungs- und Kultusvereinigungsvermögen von den nach dem 22. Oktober 1940 ergangenen Anordnungen nicht betroffen sei. [280] Die geforderte Summe wurde dann tatsächlich von der Polizeidirektion Freiburg auf das Konto der jüdischen Gemeinde in Freiburg, das damals von der „Reichsvereinigung“ und ihrem Freiburger Vertrauensmann Nathan Rosenberger verwaltet wurde, überwiesen. [281] Diese Buchung stellt den letzten verzeichneten Vorgang auf dem Kontoblatt der Israelitischen Gemeinde Freiburg dar. [282]
Die im jüdischen Zentralarchiv aufbewahrten Briefwechsel von Karl Eisemann mit dem Generalbevollmächtigten Dornes geben weitere Aufschlüsse über die Praxis der „Verwertung” des jüdischen Gemeindevermögens, das neben Gegenständen freilich auch Wertpapiere, Konten und Sparbücher umfasste. Eisemann beklagte sich bei Dornes mehrmals darüber, dass ihm von den lokalen Behörden keine oder nur unvollständige Auskünfte und Papiere der Kultusgemeinden zur Verfügung gestellt wurden. Es fiele ihm deshalb schwer, die Gemeindevermögen zu erfassen und anschließend abzuwickeln. Am 24. April 1941 schreibt er an Dornes:
„Ich bin angewiesen worden, die gesamten Vermögensbestände der Kultusvereinigungen in Karlsruhe zusammenzufassen und nur ein Bankkonto zu unterhalten. Es stellt sich heraus, dass ich über die Guthaben zahlreicher Kultusvereinigungen deshalb nicht verfügen kann, weil mir die Sparbücher fehlen. “ [283]
Als am 30. Juli 1941 eine erneute „Beschwerde“ Eisemanns bei Dornes eingeht, antwortet dieser am 11. August 1941:
„Ich habe erneut meine Aussenstellen angewiesen, alle noch in ihren Händen befindlichen Unterlagen über die jüdischen Organisationen Ihnen auszuhändigen und etwa noch verwahrte Vermögenswerte dieser Organisationen Ihnen zu übertragen. [...] Meine Aussenstellen können nicht wissen, welche Vermögenswerte von Ihnen noch nicht erfasst sind. Sie können Ihnen nur die Unterlagen zur Verfügung stellen, die sie selbst über die jüdischen Kultusvereinigungen etwa noch besitzen.“ [284]
Die Briefwechsel offenbaren, dass sowohl Dornes als auch Eisemann akribisch mit der Verwaltung und „Verwertung“ des jüdischen Vermögens befasst waren. Die lange unklar gebliebenen Zuständigkeiten sowie die direkte Zusammenarbeit mit den beteiligten Behörden gestalteten sich dabei offensichtlich besonders schwierig. Immer wieder kam es wohl auch zu Missverständnissen und Unklarheiten ob der Verfahrenswege. Am 5. Mai 1941 schreibt Eisemann an Dornes:
„Ich habe vor Kurzem festgestellt, dass das Bankguthaben einer jüdischen Kultusvereinigung dem zuständigen Landratsamt überwiesen worden war. Vermutlich ist die Überweisung zu einer Zeit erfolgt, als über die Rechtsstellung der jüdischen Organisationen in Baden Unklarheit geherrscht hat. Trotzdem bitte ich in Erwägung zu ziehen, ob nicht die Aussenstellen gelegentlich darauf hingewiesen werden könnten, dass etwa von ihnen verwaltete Vermögensbestände jüdischer Organisationen von der Beschlagnahme ausgenommen sind. Es fehlen mir insbesondere eine ganze Anzahl von Sparbüchern, deren Aufgebot ich unter Umständen beantragen müsste.“ [285]
Die Zusammenarbeit zwischen Dornes und Eisemann scheint auf der Grundlage des vorhandenen Aktenmaterials jedoch recht einvernehmlich vonstatten gegangen zu sein. Eisemann, der seine Bezirksstelle der „Reichsvereinigung“ noch bis Anfang 1945 führen konnte und erst in den letzten Kriegstagen untertauchte, bescheinigte Dornes in dessen Spruchkammerverfahren, dass er sein Amt „sauber und nicht zum Nachteil der Juden verwaltet“ hätte. [286] Da bei einem Feuer im Badischen Innenministerium zu Kriegsende sämtliche weitere Korrespondenzen oder von Dornes erlassene interne Richtlinien verloren gegangen sind [287] , ist eine valide Überprüfung dieser Einschätzung Eisemanns heute nicht mehr möglich. Fest steht jedoch, dass das jüdische Gemeindevermögen sämtlicher Kultusgemeinden in Baden an die Bezirksstelle der „Reichsvereinigung“ in Karlsruhe übertragen werden sollte und diese Vermögenswerte von der durch Himmler nachträglich verordneten Beschlagnahmung ausgeschlossen waren. Dornes unterstützte Eisemann bei der Erfassung dieser Vermögenswerte, indem er seine Außenstellen zur Kooperation aufforderte. Eisemann hatte wiederum die Aufgabe, die bei ihm eingehenden Vermögenswerte der Gemeinden zu erfassen, auf ein Konto zu überführen und der Gestapo zur Verfügung zu stellen. Anfangs sollten diese Vermögenswerte noch genutzt werden, um den zurückgebliebenen Juden Fürsorge und Unterstützungsleistungen ermöglichen zu können, nachdem sie von sämtlichen staatlichen Hilfemaßnahmen ausgeschlossen worden waren. Ab 1941 wurde das an die „Reichsvereinigung“ überführte jüdische Vermögen dann vor allen Dingen dazu genutzt, um die kostenaufwändigen Deportationen zu finanzieren. [288] Die Kaufsumme für das Freiburger Synagogengelände taucht in keiner der noch vorhandenen Korrespondenzen zwischen Eisemann, Dornes und den beteiligten lokalen NS-Behörden auf. [289] Es ist jedoch naheliegend, dass die auf ein Sperrkonto eingezahlte Summe in die Vermögenswerte der „Reichsvereinigung“, also der Gestapo, überführt und für diese Zwecke verwendet wurde. Ein anderes Szenario bezieht sich auf die Zeit unmittelbar nach den Deportationen der badischen Juden nach Gurs. Dass lokale Behörden die unklaren Verhältnisse und das behördliche Chaos unmittelbar nach den Deportationen ausnutzten, um sich am jüdischen Gemeindevermögen zu bereichern, kann auf der Grundlage des derzeitigen Erkenntnisstandes zumindest nicht ausgeschlossen werden. Fest steht auch, dass auf dem erwähnten Kontoblatt, das für die Israelitische Gemeinde von der Polizeidirektion Freiburg angelegt wurde, keinerlei Vermögenswerte verzeichnet wurden, mit Ausnahme der Beträge, die aus den Versteigerungen erzielt wurden. Vergleicht man das Kontoblatt mit dem jüdischer Privatpersonen, die für Freiburg noch zahlreich erhalten sind, fällt auf, dass in diesen Kontoblättern weitere Vermögenswerte, also auch größere Kontobewegungen, Mieteingänge etc. vermerkt wurden. Es ist also davon auszugehen, dass das Vermögen der Israelitischen Gemeinde von der Polizeidirektion nicht erfasst werden konnte, weil es im November 1940 bereits eingezogen war. Dornes ordnete am 6. November 1940 an, dass das Vermögen der jüdischen Kultusvereinigungen vorerst nicht zu „verwerten“ sei. Am 12. Dezember 1940 machte er bekannt, dass das Vermögen der Kultusvereinigungen, inklusive aller Konten, Wertpapiere etc. an die „Reichsvereinigung“ überführt werden sollen und nicht von der Beschlagnahme nach dem 22. Oktober betroffen seien. [290] Es ist deshalb sowohl denkbar, dass sich örtliche Behörden oder Privatpersonen das Hauptvermögen der Israelitischen Gemeinde Freiburg zwischen dem 22. Oktober und dem 6. November 1940 an den offiziellen Richtlinien vorbei sicherten. Genauso gut könnte das Vermögen auf die Weisung Dornes’ vom 12. Dezember aber an die „Reichsvereinigung“ übergegangen sein und dann der Aufsicht von Eisemann unterstanden haben. Als gesichert gilt in diesem Zusammenhang, dass Eisemann kaum bzw. nur sehr verzögert an die Akten der jüdischen Gemeinden in Baden gelangen konnte. Dies belegt ein weiteres Schreiben vom 15. April 1941 mit dem Betreff: „Liquidation der jüdischen Kultusvereinigungen in Baden“. Dort schreibt er an Dornes:
„Die Akten der meisten jüdischen Kultusvereinigungen in Baden sind mir nicht zugänglich. Ich nehme an, dass nach der Aktion vom 22. Oktober 1940 die Akten der Kultusvereinigungen in weitem Umfange von den Behörden sicher gestellt worden sind. Nachdem feststeht, dass die Kultusvereinigungen durch mich abgewickelt werden, wäre ich dankbar, wenn durch geeignete Weisung die nachgeordneten Behörden veranlasst würden, mir das in ihren Händen befindliche Aktenmaterial zugehen zu lassen. Ich habe bereits im vergangenen Jahr einen solchen Antrag gestellt, leider sind mir damals nur die Akten von ganz wenig Kultusvereinigungen zugeteilt worden.“ [291]
Der entscheidende Hinweis, welchen Weg das Freiburger Gemeindevermögen genommen hat, fehlt in den vorhandenen Akten. Dass die Gemeindemitglieder selbst das Geld retten konnten ist unwahrscheinlich, da sie auf das gesperrte Konto keinen Zugriff hatten. Wenn Abbuchungen gemacht wurden, was überhaupt nur für kleinere Beträge des täglichen Bedarfs möglich war, konnten diese nur durch die schriftliche Genehmigung der Behörden (zum Beispiel der Devisenstellen) sowie der Banken erfolgen. [292] Eine weitere Spur führt deshalb schließlich auch zu den Banken, die an der „Verwertung“ jüdischen Vermögens ebenfalls einen nicht unerheblichen Anteil hatten.
Die Beteiligung der Banken
Neben der örtlichen Polizeidirektion, unter Aufsicht des Generalbevollmächtigen Dornes, der „Reichsvereinigung“ sowie später den Oberfinanzpräsidien mit den untergeordneten örtlichen Finanzämtern waren natürlich auch die Banken an der Verwaltung und „Verwertung” des jüdischen Vermögens beteiligt. Dabei reagierten die Banken nicht nur auf die Vorgaben aus der Politik, sondern waren diesen in einigen Fällen sogar einen Schritt voraus. [293] Grundsätzlich ist eine große Kooperationsbereitschaft mit dem NS-Staat von Seiten der deutschen Banken zu beobachten. Ohne größere Widerstände arbeiteten sie mit den lokalen Behörden zusammen, wenn es zum Beispiel um die Aufstellung oder Verwaltung jüdischer Bankkonten ging. Für Freiburg liegen Korrespondenzen unterschiedlicher Banken vor, die bereitwillig Auskunft über die noch vorhandenen Vermögenswerte ihrer jüdischen Kunden geben und dem NS-Regime damit die Aufstellung und „Verwertung” dieser Werte erleichterten. [294] Nur kurz nach Inkrafttreten der Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben vom 12. November 1938 erteilte die Zentrale der Deutschen Bank eine Weisung an alle Filialen, die besagte, „dass man den Verfügungen der jüdischen Kunden über ihre Guthaben in Anbetracht der sich aus den neuerlichen Verordnungen ergebenden Verhältnissen im Allgemeinen nicht stattgeben könne.“ [295] Juden waren jedoch schon lange vor dieser Anordnung bei der Nutzung ihrer Konten massiv eingeschränkt. Das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Devisenbewirtschaftung vom 1.12.1936 hatte zur Folge, dass Juden, die in eine Emigration in Erwägung zogen, mit einer sogenannten Sicherungsanordnung überzogen werden konnten, die es ihnen fortan nicht mehr ermöglichte, auf ihre Konten ohne vorherige Genehmigung durch die Devisenstellen der Oberfinanzdirektionen zuzugreifen. [296] Da in den Augen des NS-Staates die Mehrheit der Juden dem Verdacht des Kapitaltransfers durch Emigration unterlag, wurde diese Sicherungsanordnung in vielen Fällen ausgesprochen, auch dann, wenn eine Auswanderung (noch) nicht unmittelbar bevorstand. [297] Die Devisenstellen wurden damit zu „zentralen Schaltstelle“ bei der Enteignung von Juden in Deutschland. [298] Nach einer am 26. April 1938 ergangenen Verordnung waren deutsche Juden dazu verpflichtet, den Finanzbehörden ihre in- und ausländischen Vermögenswerte offenzulegen und diese anzumelden. [299] Juden, die ein Vermögen über 5.000 RM besaßen, mussten detailliert über die Zusammensetzung ihrer Vermögenswerte Auskunft geben. Es sollte der komplette Besitz erfasst werden: Bargeld, Grundstücke, Spareinlagen, Bankkonten, Wertpapiere etc. [300] Das badische Finanz- und Wirtschaftsministerium hatte 1938 alle für ihren Zuständigkeitsbereich relevanten Werte addiert und kam dabei auf eine Summe von 282, 24 Mio. RM. [301]
Die Kontosperren erfassten spätestens ab Ende 1939 auch diejenigen, die aufgrund fehlender finanzieller Mittel oder aus anderen Gründen nicht an Auswanderung dachten. [302] Sie waren ebenfalls gezwungen, Sperrkonten zu errichten und ihre noch vorhandenen Vermögenswerte auf dieses einzuzahlen. Die Bank, bei der das jeweilige Sperrkonto eingerichtet wurde, zahlte entsprechende Beträge an ihre jüdischen Kunden erst aus, wenn vorab eine Genehmigung durch die örtliche Finanzverwaltung eingegangen war. [303] Die Bank fungierte in diesen Fällen als Scharnier zwischen dem jüdischen Kunden und der Finanzverwaltung. Dies traf sehr wahrscheinlich auch auf das Konto zu, auf das die Kaufsumme für die Grundstücke überwiesen worden war. Es musste als Sperrkonto bei der Deutschen Bank eingerichtet werden. Die rechtmäßigen Besitzer hatten darauf nur einen sehr beschränkten Zugriff, der stets unter Aufsicht der Behörden stand.
Am 7. Dezember 1940 erging an die Zweigstellen der Deutschen Bank in Mannheim und Freiburg schließlich eine Verfügung von Carl Dornes über die Behandlung der Vermögenswerte der deportierten Juden. Darin heißt es:
„Das Vermögen der aus Baden ausgewiesenen Juden unterliegt meiner Verwaltung. Über die von diesen Juden unterhaltenen Konten und Depots bin ich allein verfügungsberechtigt. Es dürfen deshalb Zahlungen und Verfügungen nur mit meiner besonderen schriftlichen Genehmigung geleistet oder getroffen werden. Auch bisher genehmigungsfreie Zahlungen und sonstige Verfügungen zu Lasten der genannten Konten usw. der Juden, die am 22. Oktober 1940 aus Baden ausgewiesen worden sind, sind ohne meine vorherige schriftliche Genehmigung nicht mehr zulässig. Diese Sperre bezieht sich nicht auf die Konten der Isr. Gemeinden, Wohlfahrtstellen und sonstige Israelitische Organisationen. Ich bitte jedoch, von Zahlungen aus diesen Konten einstweilen abzusehen, bis über das Verfügungsrecht über solche Konten weitere Weisungen ergehen. “ [304]
Das Schreiben macht noch einmal deutlich, dass Dornes sich zwar als Verfügungsberechtigter über sämtliche Konten der Deportierten begriff, die Konten der Israelitischen Kultusgemeinden jedoch nicht unter seiner, sondern, wie später festgelegt wurde, unter der Verwaltung der „Reichsvereinigung“ standen. Im Historischen Institut der Deutschen Bank in Frankfurt/Main sind noch einige Kontoübersichten der Israelitischen Kultusgemeinde in Freiburg erhalten. Eine Anfrage im dortigen Archiv hat ergeben, dass Übersichten zu folgenden Konten noch vorhanden sind:
Sparkonten:
- Israelitische Gemeindeverrechnung Schulfonds-Konto
- Sonderfürsorge d. Synagogenrates / Jüdische Winterhilfe
- Israelitischer Handwerker-Verein
- Israelitischer Kranken- und Sterbeverein
- Israelitischer Waisenfonds
Kontokorrentkonten:
- Israelitische Gemeindeverrechnung (Maschinenkonto)
- Israelitische Gemeinde, Stiftungsvermögen
- Israelitische Gemeinde, G&R Weil-Stiftung
Die vollständigen Akten dieser Konten
lagen der Autorin in digitaler Form vor. In keinem der genannten
Konten ist der Überweisungsbetrag
über die Summe von 67.000 RM
bzw. über 61.398 RM (Betrag
abzüglich der Abbruchkosten
für die Synagoge) zu finden. Dies
bestätigte ferner auch der Leiter des
Historischen Instituts, Dr. Martin Müller,
der die Kontoübersichten ebenfalls nach dem
Verbleib der Summe untersuchte. [305] Weitere
Akten der Israelitischen Gemeinde aus der damaligen Filiale der
Deutschen Bank in Freiburg sind im Archiv nicht erhalten. Am
ehesten wäre der Betrag wohl im Konto
„Israelitische
Gemeindeverrechnung“ (Kontokorrentkonto) zu
vermuten gewesen. Tatsächlich liegt eine
Übersicht aus dem Jahr 1939 mit der
Kontonummer 15132 mit dem Vermerk
„Gesperrt“ vor.
Außerdem ist die
Kontoübersicht mit dem Hinweis versehen:
„Scheckheft 840351-500 abhanden gekommen
beim Brand der Synagoge“ [306] .
Die einzelnen, dort aufgeführten
Beträge lassen sich aufgrund fehlender
Bemerkungen und nicht mehr vorhandener Referenzrechnungen oder
Belege nachträglich nicht mehr zuordnen. Im
Jahr 1939 datiert der höchste
Zahlungseingang mit 9.007,72 RM vom 3. Mai 1939. Im Dezember
schloss das Konto mit einem Gesamtsaldo von 25.734,78 RM.
Es ist davon auszugehen, dass Unterlagen über das Konto, das die Israelitische Gemeinde einrichten musste, damit der Kaufpreis darauf überwiesen werden konnte, heute nicht mehr vorhanden sind. Auf der Grundlage des bei der Deutschen Bank vorhandenen Aktenbestands aus Freiburg ist die Überweisung des Kaufpreises nicht nachweisbar. Allerdings wird die Überweisung der Gesamtsummer über 67.000 RM von Julius Bloch am 23. August 1939 schriftlich bestätigt. [307] Diese Summe müsste auf den vorhandenen Kontoauszügen abzulesen sein, wenn das Geld auf eines der noch einsehbaren Konten überwiesen worden wäre.
4.3 Zusammenfassung und Zwischenbilanz
Es liegt nahe, dass es sich bei der Instanz, die das Gemeindevermögen der Israelitischen Gemeinde Freiburg „verwertete“ um die „Reichsvereinigung der Juden“ handelte, die wie oben bereits beschrieben, als Unterbehörde des Reichssicherheitshauptamts zunächst für die Liquidation der Vermögenswerte aus den jüdischen Gemeinden zuständig war und daraus ab 1941 auch die Deportationen mitfinanzieren musste. Welcher Anteil des Freiburger Gemeindevermögens, wann und unter welchen Umständen an die Bezirksstelle der „Reichsvereinigung“ in Baden überführt wurde, kann auf der Basis der bestehenden Aktenlage nicht mehr eindeutig rekonstruiert werden.
Die „Verwertung“ über die „Reichsvereinigung“ wurde spätestens mit der Weisung von Dornes’ vom 12. Dezember 1940 in Baden umgesetzt. [308] Das eingezogene Vermögen, musste von den zuständigen Stellen der „Reichsvereinigung“ auf ein getrenntes „Sonderkonto W“ überwiesen werden. [309] Die dort einbezahlten Vermögenswerte standen der „Reichsvereinigung“ jedoch nicht direkt zur Verfügung. So mussten alle Ausgaben, ähnlich wie bei den gesperrten Konten der Privatpersonen, von gesonderten Aufsichtsbehörden bewilligt werden. [310]
Obwohl die Zentrale der „Reichsvereinigung“ in Berlin durch mehrere Maßnahmen versuchte, die frühen Deportationen von 1940 noch zu verhindern oder zumindest Protest dagegen zu organisieren, funktionierten die lokalen Strukturen der „Reichsvereinigung“, ganz im Sinne Himmlers, dem Chef des Reichssicherheitshauptamtes, als eine organisatorische Stütze der Gestapo. Die Schizophrenie zwischen Hilfe für die Betroffenen und Unterstützung der NS-Behörden bei den Deportationen gilt auch in der nachträglichen Betrachtung und Einordnung der Geschehnisse als symptomatisch für das Wesen der „Reichsvereinigung“: Als von Juden geführte und mit der Haltung der größtmöglichen Einflussnahme auf die Rettung der Betroffenen verbundenen Einrichtung war sie für viele jüdische Bürger die letzte verbliebene Anlaufstelle, um Fürsorgemaßnahmen, Hilfe bei Amtsgängen, Kontaktaufnahme zu Deportierten etc. zu erlangen. Auf der anderen Seite war die „Reichsvereinigung“ jedoch auch ein direktes Organ der Gestapo und ihre Vorsteher dazu gezwungen, die jüdischen Gemeinden zu liquidieren und die Deportationen ihrer eigenen schutzbedürftigen Mitglieder mit zu organisieren. [311]
Was am Ende mit den übrig gebliebenen Summen auf den „Sonderkonten“ geschah, ist heute nur in Teilen rekonstruierbar. [312] Im Juni 1943 wurde die „Reichsvereinigung“ in ihrer bestehenden Form aufgelöst, um nur wenige Tage später als sogenannten „Rest-Reichsvereinigung“ noch bis 1945 wirtschaften zu können. [313] Das Vermögen der „Reichsvereinigung“, das sich neben den Sonderkonten auch aus dem früheren Vermögen der Israelitischen Gemeinden, jüdischer nicht-rechtsfähiger Vereine und Stiftungen zusammensetzte, wurde nach 1945 von den Nachfolgeorganisationen im Rahmen der „Wiedergutmachung“ teilweise zurückgefordert. [314] Am 22. April 1963 schlossen die Nachfolgeorganisationen einen Vergleich vor dem Obersten Rückerstattungsgericht, wodurch sie mit sieben Millionen DM abgefunden wurden. Im Gegenzug verzichteten die Nachfolgeorganisationen auf die Geltendmachung noch bestehender Ansprüche auf Vermögenswerte der „Reichsvereinigung. [315] Die sieben Millionen DM wurden unter den Nachfolgeorganisationen aufgeteilt, nachdem ein dafür vereinbarter Schlüssel festgelegt wurde. [316]
Kommunen und Gemeinden interessierten sich bereits ab 1938 verstärkt für Liegenschaften jüdischer Organisationen, da mit der Verordnung vom 31. März 1938 die jüdischen Gemeinden ihre Stellung als Körperschaft des öffentlichen Rechts zugunsten eines Vereinsstatus einbüßen mussten und damit eine Einschränkung ihrer Rechte und Freiräume einherging. [317] Bereits vor 1938 waren Verhandlungen mit jüdischen Eigentümern geführt worden, die teilweise unter erheblichem Zwang und zum Nachteil der jüdischen Besitzer zu einem Kaufabschluss geführt wurden. Die Aneignung von Grundstücken zu Preisen, die teilweise weit unter dem üblichen Verkehrswert lagen, wurde nach dem Novemberpogrom 1938 zu gängigen Praxis im gesamten Reichsgebiet. [318] Zudem hatten jüdische Besitzer nun kaum mehr Einflussmaßnahmen auf den Verkaufsvorgang, die Verkaufssumme, den Zeitpunkt des Verkaufs und die potentiellen Käufer. [319] Dies wird in Freiburg durch die Tätigkeiten von Oberregierungsrat Stöckinger deutlich.
Die Beschlagnahmung und „Verwertung“ des jüdischen Vermögens war – und das wurde im oben Beschriebenen bereits deutlich – ein erbitterter Konkurrenzkampf um Einfluss, Macht und Zuständigkeiten zwischen den unterschiedlichen, beteiligten Akteuren. Das jüdische Gemeindevermögen wurde nicht wie jüdisches Privatvermögen beschlagnahmt, sondern von der „Reichsvereinigung“ verwaltet. Hierbei hatte sich das Reichssicherheitshauptamt zunächst gegen das Reichsfinanzministerium durchgesetzt und mitunter erwirkt, dass das Vermögen der „Reichsvereinigung“ als „nicht-jüdisches“ Vermögen angesehen wurde. [320] Über dieses Vermögen konnte die Gestapo frei verfügen. 1941 änderten sich die Verhältnisse wieder. Die Massendeportationen machten einen automatischen „Vermögensverfall“ schon allein aus organisatorischen Gründen notwendig. Die „Reichsvereinigung“ blieb unter der Aufsicht der Gestapo in ihrer ursprünglichen Form von 1939 dennoch bis 1943 bestehen, auch da sich Heydrich im April 1942 noch einmal mit einem Erlass an alle Polizeidienststellen richtete, in dem er erklärte, dass das Vermögen der „Reichsvereinigung“ nun ausschließlich für die Finanzierung der Deportationen genutzt werden wird. [321]
Gemessen an dem beschriebenen Unrecht, das den Juden in Freiburg und vielen anderen Orten in Deutschland widerfahren ist, nimmt die Frage nach dem Verbleib der Kaufsumme vielleicht eine untergeordnete Rolle ein. Doch steht diese Frage und damit verbundene Antworten exemplarisch auch für die perfide Systematik eines politischen und gesellschaftlichen Systems, in welchem der Massenmord mit dem kollektiven Raub von materiellen Gütern und Eigentum einherging. Fest steht, dass der Kauf unter Zwang und ohne jede Rücksicht auf die Folgen für die rechtmäßigen Besitzer erfolgte. Dabei profitierte die Stadt Freiburg von der schon geschwächten und in der Entrechtung begriffenen Stellung der Israelitischen Kultusgemeinde sowie vieler weiter jüdischer Privatpersonen und Geschäftsleute. Freiburg besaß im Jahr 1933 die viertgrößte jüdische Gemeinde Badens. [322] Von den 1.138 Juden, die zu dieser Zeit in Freiburg lebten, konnte fast keiner in Freiburg bleiben. 657 Personen wanderten aus, mindestens 350 wurden am 22. Oktober 1940 in das Konzentrationslager nach Gurs deportiert. [323] Weitere Deportationen, u.a. nach Theresienstadt folgten bis 1945. Zuletzt wurden noch Juden aus sogenannten Mischehen oder „Mischlinge“ deportiert. [324] Am 21. August 1942 mussten Nathan Rosenberger und seine Frau Martha als eine der letzten Mitglieder der jüdischen Gemeinde die Stadt Freiburg verlassen. [325] Sie wurden am Morgen in Richtung Theresienstadt deportiert. Bis dahin hat Nathan Rosenberger versucht, die Geschicke der ehemaligen Israelitischen Religionsgemeinschaft als Vertrauensmann der „Reichsvereinigung“ aufrecht zu erhalten.
1945 kehrten nur wenige zurück. Die zunächst unkoordinierte und später systematische „Arisierung“, Enteignung und Verwertung raubte den jüdischen Menschen ihre materiellen Besitztümer. Nach außen hin sollte zumindest der Anschein einer Rechtmäßigkeit gewahrt werden, de facto war es eine kriminelle und unrechtmäßige Form der Enteignung sowie eine weitere Stufe auf dem Weg zum Genozid. Die seelischen und körperlichen Besitztümer verloren die meisten im Zuge des organisierten Massenmords. Die Stadt Freiburg, die beteiligten staatlichen Stellen sowie viele einzelne Bürger haben dazu ihren Beitrag geleistet oder dies sehenden Auges zugelassen. Wie die Stadt mit diesem Erbe nach 1945 umging und was dies für die Verwendung und den Wert des Platzes der Alten Synagoge bedeutet, wird im folgenden Teil dieser Dokumentation beleuchtet.
5. Die Restitution für den Verlust des Synagogengeländes 1948
5.1 Die Situation in Freiburg nach 1945 am Beispiel Nathan Rosenbergers
Es muss ein Bild von Zerstörung, Unsicherheit, von Rat- und Trostlosigkeit gewesen sein, das Nathan Rosenberger und seine Frau Martha im Juni 1945 erblickten, als sie in ihre Heimatstadt Freiburg zurückkehrten. Drei Jahre mussten sie zuvor unter widrigsten Bedingungen, abgemagert bis auf die Knochen und mit schweren Erkrankungen im Konzentrationslager Theresienstadt ein menschenunwürdiges Dasein fristen. Nach der Befreiung des Lagers am 8. Mai 1945 stellte die Stadt Freiburg den Transport und die Verpflegung für die 27 Freiburger zur Verfügung, die das Lager überlebt hatten. Freiburg war nach dem Bombenangriff vom 27. November 1944 großflächig zerstört worden. Überall fehlte es an Wohnraum, Lebensmitteln, Kleidung und organisatorischen Strukturen. Freiburg wurde nach 1945 von Frankreich als alliierter Militärmacht verwaltet und zur neuen Landeshauptstadt bestimmt. Nach der Versorgung mit dem Nötigsten standen bald auch Fragen nach einer „Entschädigung“ für die Verfolgten des NS-Regimes im Raum. Eine „Entschädigung“ oder „Wiedergutmachung“ setzte direkt nach Kriegsende mit individuellen, zunächst unkoordinierten Unterstützungen für die Opfer des NS-Regimes ein, bestehend aus Kleider- oder Lebensmittelspenden, die Bereitstellung von provisorischem Wohnraum, kleinen monatlichen Renten etc. Für diese Ausgaben kamen in den meisten Fällen kommunale Wohlfahrtsträger auf. [326]
Als Überlebende des NS-Regimes waren auch Nathan und Martha Rosenberger auf die Hilfe durch Unterstützungsstrukturen vor Ort angewiesen. Eine eilig eingerichtete Stelle für NS-Verfolgte und KZ-Rückkehrende in der Lessingschule wurde erste Anlaufstelle und schaffte Abhilfe bei der Beschaffung von Kleidung und Lebensmitteln. [327] Auch ein kleiner Unterhalt konnte den Betroffenen gezahlt werden. Trotz dieser schwierigen Bedingungen, und der gesellschaftlichen Stimmung, die geprägt war von Misstrauen und Vorurteilen, welchen sie als KZ-Rückkehrer durch Teile der Freiburger Bevölkerung ausgesetzt waren [328] , gründete Nathan Rosenberger mit 21 weiteren Juden am 24. Dezember 1945 die neue Israelitische Gemeinde in Freiburg. [329] Rosenberger, der zu diesem Zeitpunkt schon über 63 Jahre alt war, übernahm den Vorsitz innerhalb der Gemeinde, die zu einem Großteil aus Menschen bestand, die ursprünglich nicht aus Freiburg kamen und teilweise den Status der „displaced persons“ besaßen. [330]
Sein Alter und die schweren, durch die Zeit der Inhaftierung bedingten gesundheitlichen Einschränkungen hielten ihn nicht davon ab, mit unbeschreiblicher Energie und Nachdruck für die Belange der jüdischen Gemeinde in Freiburg einzutreten. Dokumente aus dem jüdischen Zentralarchiv sowie aus dem Bestand der Israelitischen Kultusgemeinde in Freiburg belegen, dass er täglich mehrere Stunden damit verbracht haben muss, Korrespondenzen mit Überlebenden zu führen, die sich ins Ausland flüchten konnten sowie mit Behörden oder anderen jüdischen Organisationen, die ihn in seiner Arbeit unterstützten. Seine Briefwechsel sind auch eine wichtige Quelle bei der Rekonstruktion und Einordnung der Geschichte der Restitution als einem Teil der „Wiedergutmachung“ in Freiburg.
Um die Betreuung der Opfer des Nationalsozialismus flächendeckend gewährleisten zu können, ordnete die französische Militärregierung noch im September 1945 die Errichtung von zentralen Betreuungsstellen an. In Freiburg wurde die erste dieser neuen Betreuungsstellen in der Zasiusstraße installiert. [331] Eine weitere Professionalisierung und Zentralisierung der Hilfsstrukturen fand im Februar 1946 statt. In Freiburg wurde dazu die Badische Landesstelle für die Betreuung der Opfer des Nationalsozialismus gegründet. Ihr waren alle weiteren Betreuungsstellen in Südbaden unterstellt. [332] 1949 erst wurden die Betreuungsstellen zugunsten der nun verabschiedeten gesetzlichen Entschädigungsstrukturen aufgelöst. Die „Wiedergutmachung“ betreffende Aufgaben lagen in der Folge bei den Wiedergutmachungsbehörden, die bei den Finanzämtern angesiedelt waren. [333]
5.2 „Restitution“ und „Entschädigung“ im historischen Kontext der „Wiedergutmachung“
„Was in der Geschichtswissenschaft allgemein zu den guten Sitten gehört, nämlich die kritische Erörterung von in die Forschungssprache übernommenen Quellenbegriffen, hat sich bei der Beschäftigung mit der „Wiedergutmachung“ fast zum Ritual entwickelt. Jeder sich mit diesem Gegenstand beschäftigende Autor fühlt sich zunächst einmal angehalten zu erklären, dass der Begriff der „Wiedergutmachung“ angesichts der Inkommensurabilität der dahinter stehenden Verbrechen unangemessen sei. [...] Denn auch, wenn vor allem pragmatische Gründe dafür sprechen, an diesem Begriff festzuhalten, bleibt doch zu bedenken, dass er in erster Linie die Perspektive der „Gesellschaft der Täter“ und weniger die der Opfer zum Ausdruck bringt.“ [334]
Constantin Goschler fasst mit seiner
Einschätzung über die
Verwendung des Begriffs der
„Wiedergutmachung“
sehr treffend zusammen, worüber in der
Geschichtswissenschaft seit Langem Einigkeit besteht: Die
„Wiedergutmachung“
ist keine Wiedergutmachung in ihrem eigentlichen Sinn, kann sie
angesichts der unbeschreiblichen Verbrechen der Nationalsozialisten
auch niemals sein. Sie ist wohl eher als ein terminus
technicus anzusehen und mittlerweile auch ein Synonym
für die zähe und
teilweise umstrittene Phase, in der die westlichen Alliierten und
später die Bundesrepublik versuchten, den
Opfern und Verfolgten des NS-Regimes einen Teil ihres Besitzes,
ihrer Rechte und ihrer Würde
zurückzugeben. Dass dies in vielen
Fällen nur ansatzweise gelingen konnte, gilt
heute ebenfalls als unbestritten. [335] Jedoch
wird der „Erfolg“
der
„Wiedergutmachung“
auch heute noch unterschiedlich bewertet. So beschreibt Andrea
Brucher-Lembach für Freiburg sowohl die
„Restitution“ oder
„Rückerstattung“
als auch die
„Entschädigung“
als im Großen und Ganzen zum Vorteil der
Verfolgten umgesetzt. [336] Dem
gegenüber steht die Haltung Christian
Pross’ oder Jürgen
Lillteichers: Sie beurteilen die Wirkung der
„Wiedergutmachung“
für die NS-Verfolgten allgemein als eher
defizitär. [337] Um die
Situation in Freiburg und dort insbesondere den Restitutionsvorgang
hinsichtlich des 1939 unter Zwang verkauften
Grundstücke
darstellen und in den historischen Kontext
einbetten zu können, sei
zunächst eine Definition relevanter
Begrifflichkeiten sowie eine allgemeine Beschreibung der
Hintergründe und
Abläufe der einzelnen Phasen der
„Wiedergutmachung“
vorgenommen.
Der Begriff der „Wiedergutmachung“ wird in den meisten historiographischen Zusammenhängen als ein komplexes System sämtlicher Maßnahmen und Leistungen verstanden, das sowohl eine Entschädigung für erlittenes Unrecht als auch eine Rückerstattung für geraubtes Eigentum zugunsten NS-Verfolgter durch die Bundesrepublik als Rechtsnachfolgerin des NS-Staates umfasst. [338] Obwohl die „Wiedergutmachung“ als Begriff in der Vergangenheit zahlreiche Kontroversen hervorgerufen hat und auch heute noch mit einem zumindest ambivalenten Verhältnis in der Geschichtswissenschaft zur Anwendung kommt, wird er doch, meist aus Mangel an Alternativen, weiter genutzt. [339] Vor allem die juristische Besetzung der Begriffe „Restitution“, „Rückerstattung“ oder auch „Entschädigung“ machen eine Umdeutung zugunsten des Wiedergutmachungsbegriffs de facto nicht möglich. [340]
Die einzelnen Phasen der „Wiedergutmachung“ gliedern sich in Restitution oder Rückerstattung, Entschädigung, juristische Rehabilitation, Wiedergutmachung im öffentlichen Dienst sowie bei Sozialversicherungen und letztlich umfasst sie auch zwischenstaatliche Abkommen. [341] Die Entschädigungszahlungen richteten sich dabei nicht nur an Privatpersonen sondern auch an Staaten, wie zum Beispiel Israel, das im Rahmen des Luxemburger Abkommens vom 10. September 1952 insgesamt 3,5 Milliarden D-Mark von der Bundesrepublik Deutschland erhielt. 16 weitere Staaten erhielten insgesamt zwei Milliarden D-Mark. Eine vorläufige Gesamtbilanz der insgesamt geleisteten Zahlungen innerhalb der „Wiedergutmachung“ umfasst heute etwa 50 Milliarden Euro. [342]
Die früheste Phase der „Wiedergutmachung“, die ab 1947 einsetzende „Rückerstattung“, auch „Restitution“ genannt, war als zivilrechtlicher Vorgang darauf angelegt, entzogenes und geraubtes Vermögen an die rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben. Die Restitution stand deshalb in den meisten Fällen nicht unmittelbar mit der Frage der Verantwortlichkeit für den Massenmord durch die Nationalsozialisten in Verbindung. [343] Eigentumsrechtliche Fragen und die Wiedergabe geraubter Vermögenswerte standen im Zentrum der Rückerstattung. Grundsätzlich sollte die Phase der Rückerstattung dazu dienen, noch vorhandene, identifizierbare Vermögenswerte zu erfassen und diese an die ursprünglichen, meist jüdischen Besitzer, zurückzugeben. Die jeweils letzten, meist nicht-jüdischen Besitzer dieser Vermögenswerte sollten dafür in Verantwortung genommen werden. Zentral für den Bereich der Rückerstattung ist ferner, dass NS-Verfolgte juristisch in den zeitlichen Status vor der Entrechtung und systematischen Diskriminierung zurückversetzt und aus dieser Perspektive heraus die damals geschlossenen Kaufverträge neu verhandelt werden sollten. [344]
Für Vermögenswerte, die nicht mehr auffindbar waren, sollte der Staat, also die Bundesrepublik, einstehen. Hier griff ab 1949 das System der „Entschädigung“. Durch die „Entschädigung“ sollten Betroffene oder deren Nachkommen, die aufgrund von Tod, Freiheitsentzug, Schäden an Körper und Gesundheit, Verletzung des Eigentums, Verdienstausfällen, Sonderabgaben oder erbrechtlichen Beschränkungen Unrecht erleiden mussten, Unterstützung erhalten. [345] Die Praxis der „Entschädigung“ umfasste demnach eine noch stärkere moralische Komponente und tangierte damit auch unmittelbar den Bereich des Genozids und die kollektive Verantwortung der Bundesrepublik.
Wie kamen die einzelnen Phasen der „Wiedergutmachung“ in der Nachkriegszeit aber überhaupt zustande? Waren sie eine Selbstverständlichkeit oder mussten sie letztlich unter Zwang durchgesetzt werden?
Die Rückerstattung in den Besatzungszonen der westlichen Alliierten wurde maßgeblich unter Federführung und auf Initiative der amerikanischen Militärregierung durchgesetzt. [346] Als einzige alliierte Macht, die im Zweiten Weltkrieg keine Verluste auf eigenem Staatsgebiet hinnehmen musste, konzentrierte sie sich mit Nachdruck auf die Rückerstattung, vor allem die des jüdischen Eigentums. [347] So verabschiedete die amerikanische Militärregierung am 10. November 1947 zunächst im Alleingang das Rückerstattungsgesetz als Militärgesetz Nr. 59. [348] In der französischen Besatzungszone, also auch in Freiburg, wurde noch am selben Tag unter Militärgesetz Nr. 120 ebenfalls ein Restitutionsgesetz verabschiedet. [349] Dieses war allerdings weniger weitreichend im Hinblick auf die Rechte der Opfer als das der Amerikaner. So wurde das erbenlose jüdische Vermögen, also jenes Vermögen, das weder den früheren Besitzer noch deren Erben zugeordnet werden konnte, in einen allgemeinen Fonds für die spätere „Entschädigung“ überführt und nicht an die jüdischen Nachfolgeorganisationen, wie dies in der amerikanischen Besatzungszone der Fall war. [350] Außerdem mussten NS-Verfolgte, die ihren Besitz vor dem 15. Juni 1938 veräußerten und einen Rückerstattungsanspruch anmeldeten, zunächst nachweisen, dass dieser Verkauf tatsächlich unter Zwang erfolgt ist. In der amerikanischen Besatzungszone galten alle Verträge zwischen Juden und Nicht-Juden bereits ab dem Inkrafttreten der Nürnberger Gesetze im September 1935 als „unter Zwang“ abgeschlossen. Zusätzliche Nachweise hatten die Betroffenen hier nicht zu erbringen. [351] Das Restitutionsgesetz für die französische Besatzungszone umfasste insgesamt 22 Artikel und wurde in der juristischen Bewertung ebenso wie in der geschichtswissenschaftlichen Forschung als eher „dürftiges Gesetz“ eingeschätzt. [352] Das erst im Mai 1949 in der britischen Besatzungszone verabschiedete Restitutionsgesetz orientierte sich denn auch mit kleinen Unterschieden eng an dem der amerikanischen Besatzungszone. [353]
Auf deutscher Seite waren große Widerstände gegen die Restitutions-Gesetze der Militärregierungen zu beobachten. Die Ministerpräsidenten der westlichen Bundesländer sprachen sich deutlich gegen die Rückerstattung aus. Sie wurde aber nicht nur von politischer Seite, sondern auch von einem Großteil der deutschen Bevölkerung eher als ein Oktroi der Militärregierungen oder als Strafmaßnahme empfunden und nicht als ein gerechtfertigter und notwendiger Schritt auf dem Weg, den NS-Verfolgten ihre Rechte und Besitztümer zurückzugeben. [354] Darüber hinaus gab es in den ersten Nachkriegsjahren auch im Bereich des Finanzwesens Personalkontinuitäten. Dies bedeutete, dass Beamte, die für den Raub an den Juden mitverantwortlich waren, nun häufig an den Stellen saßen, die über die Restitution für dieses Unrecht befinden sollten. [355] Dennoch galt die Phase der Rückerstattung als relativ zügig abgeschlossen. In Südbaden war die Restitution bis in die Mitte der 1950er Jahre hinein weitgehend beendet. [356]
Die zweite entscheidende Phase der „Wiedergutmachung“ setzte 1949 mit den Entschädigungsgesetzgebungen ein. Die Länder, die unter amerikanischer Verwaltung standen, verabschiedeten nach wiederholt zähen Verhandlungen zwischen den beteiligten Behörden, den anderen Militärregierungen sowie Opferverbänden und internationalen Organisationen ein erstes „Entschädigungsgesetz“. Ein Jahr später, im Mai 1950, trat auch in Baden ein „Entschädigungsgesetz“ in Kraft. [357] Das bis dahin für Wiedergutmachungsfragen verantwortliche Badische Landesamt für kontrolliertes Vermögen und seine Dienststellen wurden in diesem Zusammenhang in „Ämter für Wiedergutmachung und Vermögenskontrolle“ umbenannt, wobei die Zentrale in Freiburg hierbei an Relevanz gewann. [358] Die ebenfalls wie die Gesetze der Rückerstattung von den westlichen Alliierten initiierten Grundsätze der „Entschädigung“ waren zu Beginn auf die Verwaltung der Länder gestützt. In dieser ersten Phase der „Entschädigung“ konnten NS-Verfolgte nur mit großer zeitlicher Verzögerung sowie eines hohen bürokratischen Aufwands ihre Rechte geltend machen. [359] Dies ist mitunter auf die noch uneinheitliche Organisationsstruktur und eine stärker an formalen Vorgängen orientierte behördliche Umsetzung zurückzuführen. [360] Die uneinheitliche rechtliche Lage in den unterschiedlichen Ländern führte bei den Betroffenen schnell zu einer Forderung nach Vereinheitlichung. Nach der Gründung der Bundesrepublik im Mai 1949 konnte diese jedoch nicht sofort durchgesetzt werden. Bundeskanzler Konrad Adenauer begann erst Ende September 1951 langsam Schritte in die Richtung eines Bundesentschädigungsgesetztes zu unternehmen. [361] Am 18. September 1953 konnte dann zunächst eine provisorische Form des Bundesentschädigungsgesetzes, das sogenannte Bundesergänzungsgesetz (BErgG), in Kraft treten. [362] Dieses war als Supplement zu den bereits auf Länderebene bestehenden Entschädigungsregelungen angelegt und wies noch erhebliche Mängel sowie offene Fragen die konkrete Umsetzung betreffend auf. Nach einer weiteren Überarbeitungsphase, die von einheitlicher Kritik an der ersten Fassung des Bundesentschädigungsgesetztes geprägt war, verabschiedete der deutsche Bundestag am 6. Juni 1956 das neue Bundesentschädigungsgesetz (BEG) einstimmig. [363] In der Folge konnten nun endlich Hunderttausende aus dem Kreis der NS-Verfolgten ihr Recht auf Entschädigung einfordern. [364]
Da für die Betrachtung des Recherchegegenstands vor allem die Phase der Restitution von Bedeutung ist, wird sie im Folgenden einer genaueren Betrachtung unterzogen.
Wie wurde die Rückerstattung bis 1951 im Einzelnen umgesetzt? In Baden war seit 1947 das badische Landesamt für kontrolliertes Vermögen für die Bearbeitung der eingereichten Fälle zuständig. Geschädigte waren angehalten, bis zum 15. April 1949 ihre Forderungen beim Landesamt anzumelden und gleichzeitig Klage bei den Restitutionskammern der Landesgerichte einzureichen. [365] Für die Restitution von Gebäuden und Grundstücken wurden in der Regel die noch vorhandenen Grundbucheinträge herangezogen. Bei erzwungenen Grundstückskäufen einigten sich die beteiligten Parteien in der Regel auf eine Ausgleichszahlung, die der neue Besitzer an die jüdischen ehemaligen Eigentümer zahlen musste. Von 2.700 Restitutionsfällen, die bis Ende 1949 am badischen Landesamt für kontrolliertes Vermögen verhandelt wurden, kamen etwa 1.000 durch einen Vergleich zu einem Abschluss. [366] In den drei westlichen Besatzungszonen sowie in West-Berlin wurden jüdische Nachfolgeorganisationen anerkannt, die Ansprüche auf erbenloses jüdisches Vermögen anmelden konnten. [367]
Nach Andrea-Brucher-Lembach ist heute schwer einzuschätzen, wie die Betroffenen in Freiburg die Umsetzung und den Erfolg der Restitution für sich bewerteten. Sie verweist dabei auf nicht vorhandene persönliche Zeugnisse von Geschädigten. Weiter geht sie aufgrund der fehlenden Zeugnisse davon aus, dass die Phase der Restitution als zumindest nicht „völlig defizitär“ bewertet wurde. [368] Für den Fall der Restitution der Grundstücke trifft diese Einschätzung nur teilweise zu: Die überlieferten Korrespondenzen von Nathan Rosenberger als dem ersten Vorsitzenden der neuen jüdischen Gemeinde in Freiburg, geben Einblicke in die langwierigen Prozesse und die Wahrnehmung aus der Perspektive der Geschädigten.
5.3 Der Ablauf der Restitution des Synagogengrundstücks aus Sicht des vorhandenen Quellenmaterials
„Sehr geehrte Herren!
In Beantwortung Ihres Schreibens vom 28. d. Mts, teilen wir Ihnen mit, dass wir den 10. November d. Js. in stillem Gedenken in unserer Synagoge begehen werden. Wir halten es nicht für zweckmäßig, in der Öffentlichkeit eine Gedenkstunde bzw. Gedenkfeier abzuhalten.
Hochachtungsvoll! Nathan Rosenberger“ [369]
Den Worten Nathan Rosenbergers nach zu urteilen war die öffentliche Haltung in Freiburg im Jahr der Restitution für das Synagogengrundstück nicht derart beschaffen, als wäre sie einer öffentlichen Gedenkstunde für die zerstörte Synagoge sehr zugetan. Nathan Rosenberger äußerte sich in seinen Korrespondenzen vielmehr sogar über den wieder aufgekommenen oder nie abhandengekommenen Antisemitismus in der Stadt, in der er gerade dabei war eine neue jüdische Gemeinde aufzubauen. [370] Dennoch oder gerade deshalb war Rosenberger darum bemüht, für das geraubte jüdische Kulturvermögen der Israelitischen Gemeinde im Rahmen der Restitution entschädigt zu werden. Darüber hinaus unterstützte er (ehemalige) Gemeindemitglieder dabei, ihr verlorenes Vermögen, ihre Wertgegenstände, Grundstücke und Häuser wieder zurückzubekommen oder Ausgleichszahlungen zu erhalten. Wie oben erwähnt, konnten Entschädigungszahlungen für das körperliche und seelische erlittene Unheil erst unter der ab 1949 einsetzenden Entschädigungsgesetzgebung eingefordert werden. Wie ist Nathan Rosenberger dabei vorgegangen? Rosenberger stand in engem Kontakt mit anderen jüdischen Organisationen sowie mit Vertretern der örtlichen Behörden für Wiedergutmachung. Ehemals jüdisches Eigentum, so auch Grundstücke, wurde durch die französische Militärregierung beschlagnahmt und registriert. Die Praxis der Rückerstattung in der französischen Besatzungszone sah vor, geraubte Vermögenswerte beim badischen Landesamt für kontrolliertes Vermögen anzumelden und gleichzeitig eine Klage bei den Restitutionskammern der Landgerichte einzureichen. Nur auf diesem Weg konnte die Rückerstattung geraubten Eigentums juristisch legitimiert erfolgen. In Freiburg wurden insgesamt 275 Objekte (Häuser und Grundstücke) während des nationalsozialistischen Regimes von Juden verkauft. Davon hatte die Stadt Freiburg 18 Objekte erworben. [371] Die meisten Objekte wechselten im Jahr 1938 von „nicht-arischen“ zu „arischen“ Besitzern. [372] Der Grundgedanke der Restitution bestand darin, die beim Kauf beteiligten Parteien in den Stand vor dem Vertragsabschluss zurückzuversetzen. [373] Dabei mussten sich die Kläger zum Teil auf langwierige Auseinandersetzungen mit den damaligen Käufern ihrer Grundstücke einlassen. In vielen Fällen wurde die Restitution als ein nicht rechtmäßiger Vorgang angesehen und rief in der deutschen Bevölkerung und so auch in Freiburg große Widerstände hervor. [374] Auch versuchten nicht wenige Beklagte, eine möglichst geringe Ausgleichszahlung für sich heraus zu handeln. Der Wunsch nach tatsächlicher „Wiedergutmachung“ war zu diesem Zeitpunkt alles andere als populär. So verwundert es nicht, dass auch die Stadt Freiburg eher zurückhaltend und ohne erkennbare Reue auftrat, wenn es um die rechtmäßige Rückerstattung jüdischen Eigentums ging. Andrea Brucher-Lembach hat dies im Fall des Freiburger Juden Berthold Veit nachgewiesen. So wurde Veit im laufenden Restitutionsverfahren vom Liegenschaftsamt mitgeteilt, dass er 1936 selbst für die prekäre Lage seines Betriebs verantwortlich gewesen sei, obwohl diese erst durch den Zuteilungsstopp durch die Stadt eingetreten war. [375] 1949 wurde der Kaufvertrag vor Gericht dennoch für nichtig erklärt. Die Stadt musste eine Ausgleichszahlung vornehmen, sofern sie den Betrieb behalten wollte. Die Stadt bot Veit daraufhin 80.000 D-Mark an, obwohl das Gutachten der Restitutionskammer einen Ausgleichswert von 145.000 D-Mark ermittelt hatte. Die Parteien einigten sich schließlich in einem Vergleich auf die Ausgleichssumme von 100.000 D-Mark. [376] Für Brucher-Lembach ist dieser Vorgang ein Zeichen dafür, dass Schuldbewusstsein in der Stadtverwaltung kaum vorhanden war. [377]
Nathan Rosenberger agierte bei der Restitution des jüdischen Eigentums in doppelter Funktion: Zum einen in seiner Rolle als Vorsitzender der neu gegründeten Israelitischen Gemeinde Freiburgs, also einer örtlichen Kultusgemeinde, deren Sprengel sich aufgrund der geringen Mitgliederzahl auf das gesamte Land Südbaden erstreckte. Gleichzeitig handelte er als Oberrat der Israelitischen Landesgemeinde Südbadens in Freiburg, die die übergeordnete Landesorganisation und Nachfolgeorganisation der Israelitischen Religionsgemeinschaft Badens war. [378] Über die genauen Zuständigkeiten sowie die Rechtsnachfolge der Israelitischen Kultusgemeinde Freiburg, die insbesondere im Zuge der „Wiedergutmachung“ relevant wurde, gibt ein Schreiben Dr. Julius Ellenbogens vom Badischen Oberlandesgericht an Dr. Meinhold Nussbaum von der Jewish Agency for Palestine vom 2. Februar 1949 Auskunft: Die Israelitische Gemeinde Südbadens war demnach wieder als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt [379] und hatte zudem die Eigenschaft einer Nachfolgeorganisation sowohl für die frühere Israelitische Religionsgemeinschaft Badens sowie für sämtliche örtliche israelitische Kultusgemeinden des jetzigen Landes Baden (Südbaden) angetreten.
Weiter heißt es:
„Der Oberrat der Israeliten Südbadens als Vertretungsorgan sowohl der früheren Israelitischen Religionsgemeinschaft Badens wie der israelitischen Landesgemeinde für Südbaden macht also die Restitutionsansprüche sowohl für das geraubte Vermögen der früheren israelitischen Religionsgemeinschaft Badens, soweit es sich in der französischen Zone Bandes befindet, wie für die früheren örtlichen Kultusgemeinden dieser Zone geltend.“ [380]
Diese Vorgänge nahmen auch Bezug auf die Ansprüche, die im Rahmen der „Entschädigung“ ab 1949 eingeklagt werden konnten. Die Restitution, die sich auf die Rückgabe bzw. Rückerstattung von wiederauffindbaren Vermögenswerten bezog, vollzog sich insgesamt kleinteiliger. In diesen Prozessen hatten die Kläger meist direkten Kontakt mit den einstigen nicht-jüdischen Käufern. So waren es auch vor allen Dingen zivilrechtliche Prozesse, die in den Restitutionskammern geführt wurden. [381] Im Falle der „Entschädigung“ konnten übergeordnete Behörden in die Verantwortung genommen werden. Wenn wir nun der Frage nachgehen, wie Nathan Rosenberger vorgegangen ist und welche Schritte er im Rahmen der Restitution in Freiburg erreichen konnte, bietet ein Schreiben vom 4.3.1949 an Meinhold Nussbaum eine gute Übersicht. Es sei an dieser Stelle deshalb zu weiten Teilen wiedergegeben:
„Sehr geehrter Herr Doktor!
Ihr Schreiben vom 15. Februar d. Js. erreichte mich, und wollen Sie bitte entschuldigen, wenn ich erst heute darauf antworte, jedoch, ich bin z.Zt. mit Arbeiten für die Restitution und die Wahrnehmung von Terminen in dieser Angelegenheit dermassen überlastet, dass ich kaum zu etwas anderem komme. Auf Ihr Schreiben, welches Sie s.Zt. an Herrn. Dr. Ellenbogen richteten, will ich nochmals kurz eingehen, wenn auch in grossen Zügen eine Antwort bereits erfolgte.
In der französischen Zone Badens befanden sich im Jahre 1940 vor dem grossen Abtransport der Juden nach Südfrankreich etwa 36 Gemeinden, in denen eigenes Kulturvermögen vorhanden war. – Die Aufstellung der Gemeinden finden Sie anbei. – Die einzelnen Gemeinden wurden dann in die Reichsvereinigung der Juden eingegliedert, und das Vermögen zum Teil auf Anordnung der Reichsvereinigung veräussert bzw. in die Reichsvereinigung übernommen. In den Jahren 1946/47 befasste ich mich damit, über dieses Grundvermögen die Grundbuchauszüge bzw. die noch vorliegenden Kaufverträge einzufordern, um für den Fall des Inkrafttretens des Restitutionsgesetzes gerüstet zu sein. Wie Ihnen wohl bekannt ist, trat dann am 14.11.47 [sic!] für die französische Zone das Restitutionsgesetz in Kraft, und die nötigen Schritte wurden gleich unternommen. Sämtliches Kulturvermögen, d.h. greifbares Vermögen wie Grundstücke, wird von der Israelitischen Landesgemeinde Südbaden, die vom Bad. Ministerium des Kultus und Unterrichts als Rechtsnachfolger aller ehem. Jüd. Gemeinden anerkannt ist, und die alle jetzigen Gemeindemitglieder in Baden umfasst, zurückgefordert, bzw. den ehemaligen Erwerbern, wenn sie politisch nicht belastet sind, gegen Zahlung einer Ausgleichsforderung überlassen. Sämtliche Restitutionsfälle werden vor Abschluss im Oberrat besprochen.
Zu meiner Genugtuung kann ich sagen, dass fast alle Objekte eingeklagt sind, und die Verhandlungen bereits zum Abschluss gebracht werden konnten.
Soweit es sich um Stiftungen und sonstige, d.h. nicht greifbares Vermögen, handelt, das aus den früheren Gemeinden stammt, ist dieses infolge des Verlusts sämtlicher Unterlagen hierüber sehr schwer feststellbar. In diesen Fällen kann z. Zt. noch nichts unternommen werden, da das genannte Vermögen unter die Wiedergutmachungsbestimmungen fällt, die für die französische Zone nicht herausgegeben worden sind.
[...]
Hierzu kann ich nur schreiben, dass ich es sehr bedaure, dass die IRSO [Jewish Restitution Successor Organization, Anmerkung J.W.] in der französischen Zone nicht arbeitet, dass aber bereits bezüglich der Beteiligung an der Verwaltung des in der franz. Zone zu bildenden Wiedergutmachungsfonds, in den das erblose Vermögen fällt, auch unsererseits bereits Verhandlungen aufgenommen sind, damit jedenfalls ein Mitglied des Oberrates als beratendes Mitglied in diesem Ausschuss mitarbeitet.“ [382]
Was lässt sich aus diesen Zeilen ableiten? Nathan Rosenberger beschreibt hier sehr anschaulich, welche Schritte nötig waren, um die ehemals jüdischen Objekte im Rahmen der Restitution zurückzufordern bzw. sich um Ausgleichszahlungen zu bemühen. Dafür zwingend notwendig war das Zusammentragen von Informationen und noch vorhandenen Unterlagen zu diesen Objekten. Da viele Akten kriegsverlustig waren oder in den Wirren der letzten Kriegstage vernichtet wurden, ist es bemerkenswert, dass es Rosenberger gelang, bis 1949 fast alle bekannten Objekte zurückzufordern. Er selbst sieht es als eine „Genugtuung“ an, bis zu diesem Zeitpunkt schon so weit gekommen zu sein. Rosenberger geht auch auf die Rolle der „Reichsvereinigung“ ein, die im oberen Teil dieser Darstellung schon ausführlich beleuchtet wurde. Die Ausführungen Rosenbergers stützen die Vermutung, dass das Vermögen der Israelitischen Gemeinde Freiburg an die „Reichsvereinigung“ übergegangen war. In einem weiteren überlieferten Schreiben wird Rosenberger als „Liquidator“ der Israelitischen Gemeinde Freiburgs bezeichnet. [383] Ihm oblag demnach die Aufgabe, das noch vorhandene Vermögen der Freiburger Gemeinde an die badische Zentrale der „Reichsvereinigung“ zu überführen. [384]
Darüber hinaus wird durch das Schreiben deutlich, dass die IRSO, also die jüdische Restitutions-Nachfolgerorganisation, in der französischen Zone nicht aktiv war und dies von Rosenberger bedauert wurde. [385] Erst im Rahmen der Entschädigung Anfang der 1950er Jahre konnte eine weitere jüdische Nachfolgeorganisation, die BRANCHE FRANCAISE de la Jewish Trust Corporation for Germany, Ansprüche für die jüdischen Gemeinden geltend machen. [386] In diesem Zusammenhang steht auch die Entschädigung für das nicht greifbare Vermögen, auf das Rosenberger in seinem Schreiben eingeht. Da Aufzeichnungen über Konten, Wertpapiere etc. nicht mehr vorhanden seien, würde der Verlauf der „Entschädigung“ dafür sehr mühsam werden. Nathan Rosenberger stand zur Bewältigung seiner Aufgaben in engem Kontakt mit den zuständigen Behörden, anderen jüdischen, auch international tätigen Organisationen, Überlebenden sowie deren Nachkommen.
Um die Arbeit für die Israelitische Landesgemeinde überhaupt aufnehmen zu können und für die grundlegendsten Bedürfnisse der Mitglieder sorgen zu können, wie die Bereitstellung eines Betsaals, die Wiederbeschaffung von Thora-Rollen, die Einstellung eines Rabbiners etc., bat Rosenberger beim badischen Wirtschafts- und Finanzministerium bereits im September 1945 um finanzielle Unterstützung. Das Ministerium erwiderte, dass sämtliche Mittel des Landes durch das Gesetz Nr. 53 gesperrt seien, das Ministerium aber bei der Militärregierung darum bitten könnte, der Gemeinde einen Vorschuss zur Bewältigung „reiner Kultbedürfnisse“ zur Verfügung zu stellen. [387] Das Wirtschaftsministerium stellte dem Oberrat der Israeliten darauf ein Darlehen in Höhe von 200.000 RM in Aussicht, mitunter „um den Aufbau der Vereinigung zu ermöglichen“. [388] Die Auszahlung sollte unter der Bedingung erfolgen, dass der Anspruch des Oberrates auf „Schadloshaltung aus dem von der früheren Naziregierung beschlagnahmten jüdischen Kirchenvermögen“ abgetreten wird und das Geld bei der Erfüllung dieses Anspruchs zinslos zurückgezahlt wird. [389]
Die Israelitische Landesgemeinde Südbaden sollte diesen Betrag also zurückzahlen, nachdem ihr ihm Rahmen der „Entschädigung“ Wiedergutmachungszahlungen, das jüdische Kulturvermögen betreffend, zugegangen waren. Die Sicherheiten, die Nathan Rosenberger als Oberrat in diesem Zusammenhang nannte, wurden mit zwei Millionen Reichsmark für den von ihm verwalteten Bezirk Südbaden angegeben. [390] Tatsächlich ausgezahlt wurden, dies zumindest legt das vorhandene Archivmaterial nahe, dann nur 100.000 RM, die zu zwei Chargen à 50.000 RM im März und im Juni 1946 ausgezahlt wurden. [391] Fragen zur Rückzahlung von Seiten des Ministeriums gingen schon im November 1947 bei Nathan Rosenberger ein. Damals antwortete er, dass sie zur Frage der Rückzahlung erst „nach Regelung der Wiedergutmachungsfrage Stellung nehmen, da Einnahmen nicht zur Verfügung stehen.“ [392] Im November 1949 wandte sich das Ministerium erneut an Rosenberger und bat um Vorschläge zur Rückzahlung der sich aufgrund der Währungsumstellung nun auf 10.000 DM amortisierten Darlehens. [393] Wie Rosenberger darauf reagierte und wie das Darlehen im Rahmen der „Entschädigung“ dann tatsächlich verrechnet wurde, geht aus den noch vorhandenen Aufzeichnungen der Gemeindekorrespondenz nicht hervor.
Wie ging nun aber die Restitution im Hinblick auf den hier im Fokus stehenden Forschungsgegenstand, das Synagogenareal, konkret von statten?
Die Restitution für die Grundstücke wurde am 26. November 1948 zu einem Abschluss gebracht. Die Stadt Freiburg, welche die beiden Grundstücke im März 1939 gekauft hatte und die Israelitische Landesgemeinde für Südbaden in Freiburg, als Rechtsnachfolgerin der Israelitischen Gemeinde Freiburg, einigten sich dabei in einem Vergleich. Außer dem Vertragsdokument über die öffentliche Sitzung der Restitutionskammer und einigen Dokumenten, welche die Erfassung des jüdischen Kulturvermögens dokumentieren, sind nur wenige Akten erhalten, die den Prozess bis zum Abschluss des Vergleichs lückenlos rekonstruieren könnten. [394] Relativ gut nachzeichnen und belegen lässt sich hingegen der Verlauf der Diskussion und der Umsetzung der Errichtung eines Wärterhauses mit Leichenhalle am jüdischen Friedhof in Freiburg. Zu dieser Maßnahme hat sich die Stadt gegenüber der Israelitischen Landesgemeinde für Südbaden im Rahmen des Vergleichs verpflichtet. Städtische Akten sind darüber im Freiburger Stadtarchiv umfassend vorhanden. [395]
Dem Dokument, in dem der Vergleich schriftlich fixiert wurde, ist zu entnehmen, dass der Vertrag vom 15. März 1939 nach Artikel 5 der Verordnung Nr. 120 vom 10. November 1947 „für nichtig zu erklären“ wäre, da der Kaufvertrag unter dem Einfluss moralischen Zwanges vorgenommen worden ist. [396] Weiter heißt es, dass die Israelitische Landesgemeinde für Südbaden in Freiburg „[...] hiermit auf ihre nach der Verordnung Nr. 120 bestehenden Restitutionsansprüche bezüglich der Grundstücke, Lagerbuchnummern 475 und 475/1 [verzichtet] und [...] das Eigentum der Stadt Freiburg an diesen Grundstücken an[erkennt]. Die Parteien bestätigen den Kaufvertrag und die Auflassung vom 13. März 1939.“ [397]
Im Gegenzug ging die Stadt Freiburg folgende Verpflichtung ein:
„Die Stadt Freiburg i. Br. übernimmt gegenüber der israelitischen Landesgemeinde für Südbaden in Freiburg i. Br. folgende Verpflichtungen:
- sie errichtet auf dem Israelitischen Friedhofsgelände ein Wärterhaus mit Leichenhalle. Die Ausführung wird dem vom Wiederaufbaubüro Freiburg i.Br. im Oktober 1946 gefertigten und dem Oberrat der Israeliten unterm 11. Nov. 1948 vorgelegten Plänen entsprechen. Der Bau wird im Jahr 1949 begonnen und soll nach Möglichkeit in diesem Jahr fertiggestellt werden.
- Die Stadt Freiburg übernimmt ferner die Kosten für die Einfriedung des Friedhofes im Betrag von 2.061,- DM.“ [398]
Unter Punkt 6. wurde schließlich noch vereinbart, dass die Stadt Freiburg sich verpflichtet, das Grundstück, auf dem die Synagoge stand, nicht zu „Zwecken, die eine Profanierung darstellen könnten“ zu verwenden. [399]
Wie in vielen ähnlichen Fällen, bestand die Israelitische Gemeinde als rechtmäßige Besitzerin der beiden Grundstücke nicht auf deren Rückgabe gegen Zahlung des damaligen Kaufpreises. Dieser hätte durch die Abwertung der Reichsmark nach der Währungsumstellung 6.700 DM betragen. [400] Die Entscheidung gegen den Rückkauf kann unterschiedliche Gründe gehabt haben. Zum einen war die junge Gemeinde finanziell alles andere als gut ausgestattet. Die Summe, die für den Rückkauf der früheren Grundstücke hätte aufgebracht werden müssen, stand nicht ohne weiteres zu Verfügung. Darüber hinaus konzentrierte sich die Arbeit der Gemeinde in ihren frühen Jahren nicht auf eine repräsentative Außendarstellung als Ausdruck eines gesteigerten Selbstbewusstseins, wie dies Ende des 19. Jahrhunderts der Fall gewesen ist. Der Bau einer Synagoge wurde zu dieser Zeit nicht ernsthaft in Erwägung gezogen. Der Aufbau der neuen Gemeinde, die Versorgung der Überlebenden, die Rückforderung von Vermögen, Rechten und Objekten, der Weg zurück in eine Gesellschaft, die in vielen Teilen immer noch stark antisemitisch war, all diese Aufgaben banden die meisten Ressourcen und machten in vielen Fällen pragmatische Entscheidungen erforderlich. [401] Da der Friedhof 1945 nicht mehr eingezäunt war, kam es zudem immer wieder vor, dass Grabschändungen und mutwillige Beschädigungen der Friedhofsanlage und der Gräber gemeldet wurden. Diesen Vorfällen versuchte Rosenberger durch Unterstützungsgesuche an die Stadtverwaltung sowie an das Ministerium des Innern entgegenzuwirken. Am 6. April 1946 schrieb er mit dem Betreff „Wiederinstandsetzung der israelitischen Friedhöfe“ an das Ministerium:
„[...] Hingegen sind besonders in den Städten die Zustände trostlos. Es kommen täglich aus dem Ausland jüdische Personen, besonders Wehrmachtsangehörige, die seinerzeit emigriertem und die jetzt nach den Grabstätten ihrer Eltern und Angehörigen sehen wollen. Welchen Eindruck diese verwüsteten Friedhöfe auf diese Personen machen, brauche ich Ihnen wohl nicht zu sagen. Ich bitte Sie daher dringend, dafür Sorge zu tragen zu wollen, daß nun endlich auch bald einmal dieser skandalöse Zustand ein Ende nimmt. [...]“ [402]
Tatsächlich konnte dann 1946 eine provisorische Wiederherstellung des jüdischen Friedhofs in Freiburg erreicht werden. [403] Letztlich zählte die umfassende Wiedererrichtung des jüdischen Friedhofs auch zu einer der Hauptaufgaben, um die der Oberrat der Israeliten in Karlsruhe Nathan Rosenberger nach 1945 bat. [404] Vor diesen Hintergründen verwundert es nicht, dass die Israelitische Landesgemeinde darauf ein Hauptaugenmerk richtete und die beiden Grundstücke an die Stadt Freiburg im Rahmen des angesetzten Vergleichs abtrat.
Die Stadt Freiburg stellte im Vorfeld des Vergleichs ihrerseits Kalkulationen und Überlegungen an, mit welcher Vereinbarung sie auf der Grundlage des alliierten Militärgesetzes 120 möglichst ohne größere finanzielle Einbußen eine Entschädigungsleistung an die Israelitische Gemeinde erbringen konnte. Der Vorschlag, die beiden Grundstücke, Werderstraße 1 (Gemeindehausflurstück, Nr. 475/1) und 3 (Synagogenflurstück, Nr. 475) an die Stadt abzutreten, ist auf eine Initiative der Israelitischen Landesgemeinde zurückzuführen. Dies belegt ein Schreiben des Oberrats an die Stadtverwaltung vom 11. August 1948. [405] Daraufhin fertigte das Wiederaufbaubüro unter dem bereits bekannten Direktor Schlippe Pläne und einen Kostenvoranschlag für die Errichtung dieser Bauten an. [406] Nur einen Tag später gab das Liegenschaftsamt seine Einschätzung zu dem Vorschlag ab, die Errichtung der Bauten im Tausch gegen die beiden Grundstücke zu veranlassen:
„[...] Die Restitutionssumme, die der Stadt Freiburg i.Br. zu ersetzen wäre, beträgt 6.700 DM. Der nochmalige Ankauf des Geländes würde der Stadt sehr hoch zu stehen kommen. Der Voranschlag für die Errichtung der geplanten Bauten sieht 50.000 DM vor. Dieser Betrag ist als Höchstbetrag anzusehen und soll dem Abschluss der „Gütlichen Vereinbarung“ dienen. [...]“ [407]
Nathan Rosenberger ließ daraufhin mitteilen, dass er erst dann zum Abschluss einer „Gütlichen Vereinbarung“ imstande sei, wenn einwandfrei geklärt sei, in welcher Art der Aufbau des Wärterhauses mit Leichenhalle auf dem jüdischen Friedhof erfolgen würde und wenn die Höhe der Entschädigung, die für das ehemalige Synagogengelände zu bezahlen sei, feststünde. [408] Die Stadt schloss daraus, dass der Oberrat die Summe für die beiden Grundstücke noch einmal bezahlt haben möchte und stellte daraufhin Vergleichsrechnungen an :
„[...] Die Stadt Freiburg i.Br. hat im Jahr 1939 für die 23 a 19 ar 67.000 RM bezahlt. Nach der Verordnung Nr. 120 wäre der Stadt Freiburg i.Br. bei einer Rückgabe des Geländes an den Israelitischen Oberrat, von diesem die abgewertete Kaufsumme 10:1 von 67.000 RM = 6.700 DM herauszuzahlen. Wenn die Stadt Freiburg im Besitze des Geländes bleiben will, müsste somit noch eine restliche Kaufsumme von 60.300 DM vergütet werden, immer unter der Voraussetzung, dass der Oberrat den damaligen Kaufpreis von 28 RM pro qm auch heute als ausreichend anerkennt. Herr Rosenberger, als Vorsitzender des Oberrats, ist nun wohl der Meinung, dass aus diesem Betrag zunächst die Baukosten für das Wärterhaus mit Leichenhalle zu bestreiten wären; voraussichtlich erhebt er auch Anspruch auf Barauszahlung des Betrages, der nach Errichtung der Bauten am Judenfriedhof aus dieser Summe von 60.300 DM übrig bleibt. [...]“ [409]
Am 26. November 1948 erfolgte schließlich dennoch die „Gütliche Vereinbarung“ vor der Restitutionskammer, in der die Abtretung der beiden Grundstücke gegen die Einfriedung und die Errichtung eines Wärterhauses mit Leichenhalle beschlossen wurde. Die Kosten für die Einfriedung wurden in diesem Zusammenhang mit 2.100 DM angegeben. Ein später aktualisierter Kostenvoranschlag für die Errichtung der Bauten vom 14. März 1949 belief sich auf eine Summe von 52.000 DM. Im weiteren Verlauf mussten die Ausgaben auf städtischer Seite weiter nach oben korrigiert werden, u.a. da nachträglich die Instandsetzung der Friedhofswege sowie die Rasen- und Heckenbepflanzung am Friedhofsvorplatz beauftragt wurden. Der abschließende Abrechnungsnachweis vom 12.05.1952, ausgestellt vom städtischen Hochbauamt, weist schließlich eine aufgewendete Gesamtsumme von 59.443,28 DM auf. [410]
Im Vorfeld des Vergleichs wurde durch die französische Militärregierung eine Aufstellung sämtlicher (noch auffindbarer) Objekte des jüdischen Kulturvermögens, die Gemeinde in Freiburg betreffend, eingefordert oder selbst angelegt. [411] Diese Aufstellung umfasste neben den Objekten in Freiburg auch Grundstücke und Häuser in Breisach, Eichstetten und Ihringen. Die Objekte wurden mit ihren Lagebuchnummern, den Adressen sowie mit (geschätzten?) Werten versehen. So sind auch die beiden im März 1939 veräußerten Grundstücke „Werthmannplatz 1 und 3“ dort aufgeführt. Nr. 475 wurde mit einem Wert von 71.100,- DM versehen, Nr. 475/1 mit 18.400,-. Diese Zahlen tauchen auch noch einmal in einem Formular des Landesamts für kontrolliertes Vermögen vom 10. Mai 1949 auf. Hierin wird ein Buchungsvorgang vermerkt, der wie folgt beschrieben ist:
„Aufhebung der Sperre durch die Militärregierung v. 4.6.1949 (Vergleich vor der Restitutionskammer Or 100/48)“ sowie „Abgang DM 71.100,- / 18.400,-“ [412] Diese Zahlen werfen einige Fragen auf: Wie setzen sich der hier angegebenen Werte zusammen? Basieren die Werte auf einer Schätzung? Welche Bedeutung hatten sie für den Vorgang und den Umfang der Restitution?
Die erwähnte „Aufhebung der Sperre“ bezieht sich auf den Sperrvermerk im Grundbuch, den die französische Militärregierung auf alle Objekte jüdischen Kulturvermögens eintragen ließ, um diese Objekte vor unlauterer Verwendung, Verkauf, Weitergabe etc. zu schützen. Durch den Abschluss des Vergleichs im November 1948 wurde dieser Sperrvermerk aufgehoben, die Grundstücke gingen dadurch final an die Stadt Freiburg über. [413] Es fällt auf, dass sich die beiden Summen im Wert deutlich voneinander unterscheiden. Zwar ist das Grundstück, auf dem das Gemeindehaus stand, mit 922 Quadratmetern um ca. 35 % kleiner als das, auf dem sich die Synagoge befand (1.397 qm). Es ist dennoch denkbar, dass das angegebene und für die Restitution relevante Kulturvermögen von 71.100 DM für dieses Grundstück auch das zerstörte Synagogengebäude umfasste. Da das Gemeindehaus nicht durch den unmittelbaren Einfluss des NS-Regimes, sondern durch einen Bombenangriff zerstört wurde, wird es in diesem Zusammenhang nicht als restitutionsrelevantes Objekt behandelt. Diese Überlegung wäre auch insofern schlüssig, da der Wert der beiden Grundstücke bei einem 1950 angestellten Tausch zwischen der Stadt Freiburg und der Universität lediglich mit einem Wert von insgesamt 40.000 DM angegeben wurde. [414]
Wenn nun in dem Buchungsvorgang von einem „Abgang DM“ die Rede ist, ist dies gleichzusetzen mit einer Subtraktion dieser Werte vom jüdischen Kulturvermögen? Demnach stünde dem nachweisbaren Vergleichsgegenstand der Stadt Freiburg, bestehend aus der Errichtung des Wärterhauses und der Einfriedung des Friedhofs, die zusammen mit 59.443,28 DM veranschlagt wurden, ein eingetragener kultureller Wert von insgesamt 89.500,- DM gegenüber. Inwieweit spielten diese Werte bei der „Gütlichen Vereinbarung“ vom 26. November 1948 eine Rolle? Welchen Zweck erfüllte die Aufstellung überhaupt? Da weitere Dokumente, zum Beispiel erläuternde Korrespondenzen, in diesem Zusammenhang nicht überliefert sind, können diese Fragen hier nicht beantwortet werden.
Nathan Rosenberger war über den Verlauf der Wiederherstellung des Friedhofs und der Errichtung der angrenzenden Bauten zeitweise sehr unzufrieden. Er bezog sich in mehreren Beschwerden über den Baufortschritt auf die in der „Gütlichen Vereinbarung“ getroffene Zusicherung, dass die Bauten bis zum Jahresende 1949 errichtet werden sollen:
„ Da die Angelegenheit der Fertigstellung des Gebäudes für uns, wie Ihnen schon des öfteren schriftlich und auch mündlich geschildert, sehr dringlich ist, bitten wir Sie hiermit nochmals zu veranlassen, dass eine umgehende Fertigstellung erfolgt, damit das Haus beziehbar ist, da wir uns sonst leider gezwungen sehen, vom dem s.Zt. abgeschlossenen Vergleich zurückzutreten und den Bau auf eigene Kosten weiterfertigstellen zu lassen. [...]“ [415]
Die Stadt Freiburg rechtfertigte die verzögerte Umsetzung des Baus mit fehlenden Mitteln und der allgemein schlechten wirtschaftlichen Lage. Am 5. Mai 1950 bot Rosenberger der Stadt daraufhin ein Darlehen über die noch fehlenden 16.600 DM an, um die Fertigstellung zeitnah erreichen zu können. [416] Die Stadt, die dieses Angebot zunächst annehmen wollte, konnte die fehlenden Mittel bis September 1950 schließlich durch ein Darlehen der Volkshilfe aufbringen. [417] In Briefen an ehemalige Freiburger Gemeindemitglieder berichtet Rosenberger häufig über den Fortschritt der Einfriedung und Wiederherstellung des Friedhofs. [418] Noch häufiger erreichten ihn Nachrichten von ehemaligen Gemeindemitgliedern, die sich um die letzte Ruhestätte ihrer Angehörigen sorgten. Rosenberger bat bei der Beantwortung teilweise um Spenden zur Wiederherstellung des Friedhofs. [419] Auch hier wird deutlich, dass es für die 1945 neu gegründete Gemeinde ein besonders wichtiges Anliegen gewesen sein muss, den Friedhof möglichst bald wieder nutzen und die dort bestatteten Toten in Ehren halten zu können. Vor dem Hintergrund der Altersstruktur der neu gegründeten Gemeinde, die zu diesem Zeitpunkt überwiegend aus älteren Menschen bestand, ist dieses Bedürfnis ebenfalls nachvollziehbar.
Die in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 zerstörte Synagoge wurde in der „Gütlichen Vereinbarung“ vom 26. November 1948 nicht mit berücksichtigt. Der Vergleich bezog sich lediglich auf die beiden Grundstücke. Eine Entschädigung für die zerstörte Synagoge hat die Gemeinde zumindest im Rahmen dieses Restitutionsvorganges nicht erhalten. [420] Das auf dem Nachbargrundstück der Synagoge stehende ehemalige Gemeindehaus der Israelitischen Gemeinde wurde durch den Bombenangriff auf Freiburg zerstört. Es ist davon auszugehen, dass eine „Entschädigung“ für die zerstörte Synagoge im Rahmen der zweiten Phase der „Wiedergutmachung“, in der es auch um den immateriellen Schaden an den jüdischen Gemeinden ging, verhandelt wurde. Dies zumindest legen die erhaltenen Briefwechsel von Nathan Rosenberger mit dem Freiburger Wohnungsamt und dem Kultusministerium nahe. Anfang der 1950er Jahre bemühte sich Rosenberger nämlich um den Umbau eines Wohnhauses, um dort eine neue, provisorische Synagoge einzurichten. Dazu führte er Ende 1951 eine Unterredung mit dem damaligen Staatspräsidenten Leo Wohleb. Dieser bekräftigte in einem Schreiben vom 4. Januar 1953:
„[...] daß ich es für eine vornehmliche Wiedergutmachungspflicht ansehe, der jüdischen Gemeinde aus dieser unerträglichen Lage herauszuhelfen und zu diesem Zweck der Landesregierung vorzuschlagen, zunächst einen Betrag von DM 50.000,- (Fünfzigtausend Deutsche Mark) für diesen Zweck in den Staatshaushalt einzusetzen. “
Wohleb begründete dies mit den Eindrücken aus dem früheren Gespräch mit Rosenberger:
„Sie stellten mir unter Bezugnahme auf die seinerzeitige Zerstörung der Synagoge und des daneben liegenden Betsaales der israelitischen Kultusgemeinde dar, daß bis jetzt von einer Wiedergutmachung nichts erfolgt sei, insbesondere auch, daß Sie nicht einmal Gelegenheit hätten, in anständiger und einigermaßen würdiger Weise Ihren Gottesdienst zu begehen.“ [421]
Die Israelitische Gemeinde war nunmehr auf der Suche nach einem geeigneten Haus für die Unterbringung einer neuen Synagoge. Dabei scheint sie auch Interesse an einem Grundstück in der Eggstaße im Waldseegebiet gehabt zu haben. Es sind mehrere Abschriften eines anonymen Schreibens aus der Nachbarschaft dieses Grundstücks überliefert, in dem sich Anwohner deutlich und drohend gegen dieses Vorhaben aussprechen:
„Im Waldseegebiet ist eine neue Nachbarschaft gegründet worden. Diese hat sich auch mit Ihrem Plan, in der Eggstrasse ein Haus für jüdische Kultzwecke zu erwerben, befasst. Dazu seien Ihnen in Ihrem eigenen Interesse folgende Bemerkungen gemacht:
- Im Waldseegebiet wohnten früher prozentual die meisten Nazis. Sie wissen, dass sich nicht alle bekehrt haben und können sich denken, mit welchen Gefühlen Sie hier erwartet werden.
- Es hat sich herumgesprochen, dass Sie bei der Sammlung des von der Frau Bundespräsident Heuss ins Leben gerufenen Müttergenesungswerks einen Beitrag abgelehnt haben!!!
- Solange die Bestimmung besteht, dass Wohnräume nicht für zweckfremde Unternehmen verwandt werden dürfen, wird gegen ihr Vorhaben gekämpft.
- Es wird begrüsst und befürwortet, dass die jüdische Gemeinde, denen man s.Zt. in so unerhört brutaler Weise das Gotteshaus niedergebrannt hat, wieder ein solches erhält. Es sollte aber dort wieder hingestellt werden, wo es war bezw. es sollte ein würdiger Platz zu einem Neubau bereitgestellt werden, Die Mittel müssten von den Mordbrennern aufgebracht werden.
Die Nachbarschaft Waldsee. Ohne Unterschrift“ [422]
Die Vorbehalte, über die Nathan Rosenberger gegenüber ehemaligen Gemeindemitgliedern berichtete, traten hier ganz offen zu Tage. Die Abspaltung der NS-Vergangenheit mit ihren Gräueltaten von der eigenen Lebensrealität und die Abschiebung der alleinigen Verantwortung an die „Täter“ war typisch für den Umgang der deutschen Mehrheitsgesellschaft mit der NS-Zeit bis in die 1970er Jahre hinein. [423] Hier wird diese Annahme offenbar und zeigt, unter welch schwierigen und bestimmt auch schmerzhaften Bedingungen Nathan Rosenberger versuchte, die jüdische Gemeinde in Freiburg wieder zu einem integralen Bestandteil der Freiburger Stadtgesellschaft zu etablieren.
Die jüdische Gemeinde hatte schließlich dennoch eigene Mittel aufgebracht, um ein Grundstück samt Wohnhaus, diesmal in der Holbeinstr. 25, zu erwerben. [424] In den Räumlichkeiten dieses Hauses sollten der künftige Betsaal sowie weitere Gemeinderäumlichkeiten untergebracht werden. Um dies realisieren zu können und den noch dort lebenden Mietern alternative Wohnungen anbieten zu können, ersuchte Rosenberger Unterstützung beim Wohnungsamt Freiburg. Dazu heißt es in einem Schreiben Nathan Rosenbergers an das städtische Wohnungsamt Freiburg vom 14. August 1952:
„Die damalige Militärregierung hat durch das Wohnungsamt der Stadt Freiburg von ihr beschlagnahmte Räume für unsere Verwaltung zur Verfügung gestellt, in denen der neugebildete Oberrat untergebracht wurde. Am Samstag und unseren Feiertagen mussten wir, um unsern Gottesdienst notdürftig abhalten zu können, die Büros jeweils ausräumen, um die Räume zu einem Betsaal herzurichten. Dieses ist der Stadtverwaltung wohl bekannt, denn schon vor mehreren Jahren wandten wir uns an den Herrn Oberbürgermeister, um uns ein Haus zur Verfügung zu stellen, das den Anforderungen einer Religionsgemeinschaft entspricht, ganz besonders wo wir unsern Gottesdienst und die Versammlungen der Gemeindemitglieder ungestört von den Mitbewohnern des Hauses abhalten können. [...]“ [425]
Ein Neubau wurde aber von Seiten der Gemeinde zunächst verworfen, wie dem Schreiben weiter zu entnehmen ist:
„Wir haben aber, da das Bauen viel zu teuer heute käme, uns entschlossen, ein geeignetes Grundstück zu kaufen und den Kaufpreis vorzulegen. Dieses geeignete Grundstück haben wir in der Holbeinstr. Nr. 25. gefunden und erworben." [426]
Nathan Rosenberger bat das Wohnungsamt darum, bei der Freimachung der benötigten Räumlichkeiten unterstützend tätig zu werden. Im Gegenzug bot er Wohnraum für die betreffenden Mietparteien in der Oberriederstraße Nr. 21 sowie in der Hans-Jakobstraße Nr. 8 an. [427] Zwei Monate später warb er beim baden-württembergischen Kultusministerium unter Berufung auf die Gespräche mit dem ehemaligen Staatsminister Wohleb um finanzielle Unterstützung bei der Einrichtung bzw. „Errichtung“ einer Synagoge. [428] Darin schreibt er:
„Die Erstellung einer Synagoge ist schon von staatswegen von grösster Wichtigkeit, denn es wäre die einzige in ganz Südbaden, in der sich an den hohen Feiertagen die im Lande verstreut lebenden Juden zusammenfinden, um gemeinschaftlich mit ihren Glaubensbrüdern ihre religiösen Pflichten erfüllen zu können; dazu kommt, dass die jüdischen Besucher der zahlreichen Kurorte im Schwarzwald den Wunsch haben, an den Feiertagen an einem Gottesdienst teilzunehmen.“ [429]
In einem auf diesen Vorgang bezugnehmenden Brief schrieb der Architekt Ernst Guggenheimer am 21. November 1952 an Rosenberger, dass „[...] man ersthafte Beratungen darüber abhalten [würde], ob die Summe von DM 50.000,- [...] in den Etat für das Jahr 1953 eingebracht werden kann.“ [430] Guggenheimer, der den Neubau der Stuttgarter Synagoge von 1951-52 als verantwortlicher Architekt realisierte, bezog sich in seinem Schreiben auf die damalige bereitwillige Unterstützung des Kultusministeriums beim Neubau in Stuttgart und hoffte auf einen ähnlichen Verlauf in Freiburg. [431]
Dass die für 1953 angedachten 50.000 DM tatsächlich ausbezahlt wurden ist unwahrscheinlich, da darüber in den Akten der Israelitischen Gemeinde weder Belege noch weitere Korrespondenzen existieren. Fest steht jedoch, dass die Israelitische Gemeinde die Räumlichkeiten in der Holbeinstr. 25 beziehen konnte und dort ein provisorischer Betsaal untergebracht wurde. [432] Nathan Rosenberger zog mit seiner Frau ebenfalls in die Holbeinstraße. Kurz nach dem Einzug in die neuen Räumlichkeiten verstarb Nathan Rosenberger jedoch am 23. Mai 1953 im Alter von 78 Jahren. [433] Bis zuletzt hatte er sich mit all seiner noch verbleibenden Kraft für die Belange der Israelitischen Landesgemeinde für Südbaden in Freiburg eingesetzt. Für seine in Theresienstadt erlittenen gesundheitlichen Schäden wurde er selbst nie wirklich entschädigt. Das Wiedergutmachungsamt erkannte seinen schlechten gesundheitlichen Zustand nicht als eine Folgewirkung der Haftzeit in Theresienstadt an und lehnte seinen Antrag auf „Entschädigung“ aus dem Jahr 1951 deshalb ab. [434] Nachdem er dagegen Klage einreichte, von Seiten des Amtes jedoch erneut kein Zusammenhang zwischen seinen Erkrankungen und der Haftzeit gesehen wurde, bot ihm das Wiedergutmachungsamt schließlich eine einmalige Zahlung von 1.000 DM an, wenn er auf sämtliche Rentenansprüche verzichte. Diesen Vorschlag nahm Rosenberger an. Da dieser Vorschlag jedoch nur zwei Monate vor seinem Tod unterbreitet wurde, ist ungewiss, ob er das Geld überhaupt noch in Anspruch nehmen konnte. [435]
5.4 Beurteilung der Restitution aus heutiger Sicht
Auf der Grundlage des für den thematischen wie zeitlichen Abschnitt der „Wiedergutmachung“ eingesehenen Archivmaterials, fällt es schwer, eine abschließende „Beurteilung“ der Restitution für das Synagogen- und Gemeindehausareal aus heutiger Sicht vorzunehmen, auch, da weitere Aussagen von Gemeindemitgliedern der Israelitischen Gemeinde hierzu nicht überliefert sind. [436] Auch ist dies nicht der Ort, um eine wissenschaftlich fundierte Einschätzung über den Verlauf der „Wiedergutmachung“ in Freiburg im Allgemeinen vorzunehmen. Dies wurde von Andrea Brucher-Lembach teilweise schon sehr ausführlich unternommen. [437] Der Fokus der vorangegangenen Betrachtung lag auf dem Restitutionsprozess für das 1939 von der Stadt Freiburg gekaufte Synagogenareal. Weitere, auch die Phase der „Entschädigung“ betreffenden Entwicklungen und Zeugnisse wurden zur Kontextualisierung des Vorgangs randständig herangezogen, aber bewusst nicht näher beleuchtet.
Die meisten Verträge, die zwischen 1938 und 1945 zwischen Juden und Nicht-Juden in Freiburg eingegangen wurden, wurden im Zuge der Restitution für „nichtig“ erklärt. [438] Auch im Falle des 1939 abgeschlossenen Kaufvertrags um das Freiburger Synagogenareal wurde zunächst festgehalten, dass dieser „für nichtig zu erklären wäre“. [439] Jedoch bestätigten die beiden am Vergleich von 1948 beteiligten Vertragsparteien trotz dieser Feststellung schon im nächsten Abschnitt den Kaufvertrag. Die beiden Grundstücke blieben darauf im Besitz der Stadt Freiburg. Gemessen am reinen Vergleichswert vollzog sich diese Vergleichsverhandlung eher zum Nachteil für die Israelitische Landesgemeinde für Südbaden in Freiburg. Dieser Umstand ist jedoch im Kontext der damaligen Verhältnisse zu beurteilen. 1948 war die Gemeinde dringender auf die Wiederherstellung ihres Friedhofes angewiesen als auf die Rückgabe eines mit negativen Erinnerungen belegten Grundstücks, das mitten in der Stadt lag. Das Selbstbewusstsein, Teil einer Stadtgesellschaft zu sein, hatte das nationalsozialistische Regime bei den jüdischen Gemeinden zudem mit großem Erfolg ausgelöscht. Dass jüdische Gemeinden wieder ein essentieller Teil deutscher Kommunen werden, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorstellbar. Es standen sich also zwei vollkommen ungleiche Vergleichsparteien gegenüber: Die jüdische Gemeinde, als Geschädigte, und die Stadt, die, wie oben gezeigt, nicht immer ein Unrechtsempfinden aufbringen konnte und teilweise auf alte Beziehungen und Einflüsse zurückgreifen konnte. In vielen Fällen saßen die jüdischen Gemeinden, vor allem dann, wenn sie nicht durch größere organisatorische Strukturen unterstützt werden konnten, „am kürzeren Hebel.“ Dass dies nicht in allen Städten so eingetreten ist, zeigt das Beispiel Mannheim.
Die Mannheimer Hauptsynagoge wurde in der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 geschändet und zu weiten Teilen zerstört. Obwohl die Stadt das Gelände im August 1939 für 34.000 RM von der Israelitischen Gemeinde Mannheim abkaufte wurde die Ruine der Synagoge nicht abgetragen. Nach 1945 einigten sich die wieder gegründete Israelitische Gemeinde Mannheim, die israelitische Religionsgemeinschaft Baden und die JRSO als jüdische Nachfolgeorganisation für die amerikanische Besatzungszone darauf, dass die JRSO die Restitutionsansprüche alleinig geltend machen würde. In einem Vergleich zwischen der Stadt Mannheim und der JRSO im Jahr 1951 gab die Stadt Mannheim das Grundstück an die JRSO zurück. Diese trat im Gegenzug ihren Anspruch an der Kaufsumme, die der Israelitischen Gemeinde Mannheim damals, wie auch in anderen Kommunen, nicht frei zur Verfügung stand, an die Stadt Mannheim ab. In einem zweiten Vergleich einigte sich die Stadt Mannheim mit der Oberfinanzdirektion Karlsruhe darauf, dass der Kaufpreis als entzogen galt. Die Oberfinanzdirektion war als Vertreterin des Deutschen Reiches daraufhin schadensersatzpflichtig. [440] Oberbürgermeister Heimerich setzte sich daraufhin sehr energisch für den Wiederaufbau der Synagoge und die Einrichtung einer Gedenkstätte ein. Diese Ideen konnten jedoch nicht weiterverfolgt werden, da die jüdische Gemeinde in Mannheim noch zu klein war, um eine große Hauptsynagoge nutzen und unterhalten zu können. Die Gedenkstätte wurde nicht realisiert, da die hessische Treuhand, die das Synagogengrundstück nach der Restitution von der JRSO abgekauft hatte, von der Stadt Mannheim einen zu hohen Preis für den Rückkauf verlangte. Erst nachdem der Neubau einer Synagoge in der Maximilianstraße 6 beschlossen war, wurde die Ruine der Synagoge abgetragen. Auf dem Grundstück entstand ein Wohnhaus, in dessen Eingangsbereich Anfang der 1960er Jahre eine Gedenkplatte angebracht wurde, die an die Geschichte des Grundstücks erinnert. [441] Das Beispiel zeigt, dass sich die hier beteiligten Parteien zu beidseitig vertretbaren Konditionen offensichtlich relativ schnell einig wurden und darüber hinaus auch, dass sich einzelne Verantwortliche auf städtischer Seite, wie Oberbürgermeister Heimerich, stark für einen würdigen Umgang mit dem Gelände eingesetzt haben, auch wenn dies nicht von besonderem Erfolg gekrönt war.
Abschließend ist festzuhalten, dass ohne das engagierte Eintreten Einzelner, wie Nathan Rosenberger, der sich in seiner Funktion als Oberrat um die Restitution sämtlicher das jüdische Gemeindevermögen in Südbaden betreffenden Objekte kümmerte, die Bilanz für die jüdische Gemeinde in Freiburg sicherlich negativer ausgefallen wäre. Die Betroffenen waren mit der Orientierung innerhalb der länderdivergierenden Gesetzgebung sowie deren Umsetzung in den meisten Fällen überfordert. Viele stellten ihre Restitutionsansprüche aus dem Ausland und konnten auf lokalen Veränderungen und Entscheidungen nur zeitversetzt Einfluss nehmen. So ist es nicht verwunderlich, dass Nathan Rosenberger sich Einschätzungen und Informationen von größeren (jüdischen) Organisationen und befreundeten Anwälten beschaffte, um die wichtigsten Schritte einleiten zu können.
Es bleibt die Tatsache bestehen, dass Rosenberger gegen Widerstände auf unterschiedlichen Ebenen, nicht nur auf der Ebene der Behörden, sondern auch innerhalb der Freiburger Stadtgesellschaft, ankämpfen musste. Die Anfangsphase der „Wiedergutmachung“ fiel in eine Zeit, in der sich die Mehrheit der Deutschen nicht mit der Schuldfrage oder treffender, mit der Frage nach Verantwortung für das NS-Unrecht, auseinandersetzen wollte. [442] Wenn es um Verantwortungsübernahme ging, wurde diese entweder von den Militärregierungen eingefordert oder allein den „Tätern“ des NS-Regimes zugeschoben. Vor allem dem raschen Drängen der Militärregierungen in den westlichen Besatzungszonen ist es zu verdanken, dass die „Wiedergutmachung“ bereits 1947 anlaufen konnte. In den Jahren zuvor hatten engagierte Bürgerinnen und Bürger, darunter sehr oft Menschen, die selbst zum Kreis der NS-Verfolgten gehörten, sich für andere Betroffene eingesetzt und durch ehrenamtliche Arbeit in den ersten, provisorisch eingerichteten kommunalen Versorgungsstellen die größte materielle Not lindern können.
Die Erinnerungen an die Gräueltaten sollten noch lange Zeit verdrängt werden, bevor sie durch die nachkommenden Generationen mehr und mehr eingefordert und allmählich ein Teil des öffentlichen Bewusstseins in der Bundesrepublik werden konnten.
6. Der Platz der Alten Synagoge nach 1948 – Zwischen „Profanierung“ und beginnender Gedenkkultur
6.1 Die Eigentumsverhältnisse von 1948 bis 1978 im Überblick
Die nachfolgenden Kapitel sollen einen Überblick über die Besitzverhältnisse des Platzes der Alten Synagoge, der nach 1945 zunächst wieder „Werthmannplatz“ hieß, von 1948 bis 1978, dem Jahr des letzten nachvollziehbaren Besitzwechsels, vermitteln. Dabei werden zunächst die zentralen Stationen, in welchen es zu einem Besitzer-Wechsel gekommen ist, chronologisch nachgezeichnet und durch eine visualisierende Skizze (vgl. Anlage 2 im Anhang) ergänzt. Im darauffolgenden Kapitel wird der Fokus auf den unterschiedlichen Nutzungsideen bzw. deren Umsetzung sowie auf den Ansätzen der vor Ort beginnenden Gedenkkultur an die zerstörte Synagoge liegen.
Da zur jüngeren und jüngsten Geschichte des Platzes der Alten Synagoge kaum wissenschaftliche Untersuchungen vorliegen, stützt sich dieser Teil der Dokumentation vorwiegend auf Archivalien aus dem Stadtarchiv Freiburg, aus dem Staatsarchiv Freiburg sowie aus der Registratur des Freiburger Liegenschaftsamtes. Ergänzt werden die daraus rekonstruierbaren Entwicklungen um Zeitungsartikel und öffentliche Stellungnahmen.
Schon Anfang des 20. Jahrhunderts unter dem Eindruck einer wachsenden und prosperierenden Stadt rückten die Grundstücke, die sich entlang der ehemaligen Befestigungsanhöhe in Freiburg, dem Rempart, befanden, mitunter in das Interesse der Stadt. Auf der direkten Verbindung zwischen Altstadt und Bahnhof war dieses Areal hoch frequentiert. Spätestens mit dem Bau des Stadttheaters und des Kollegiengebäudes I der Universität besaß das Areal auch einen repräsentativen, auf Außendarstellung angelegten Charakter. Mit der Zerstörung der Synagoge durch die Nationalsozialisten und des angrenzenden jüdischen Gemeindehauses durch den Bombenangriff auf Freiburg 1944 entstand relativ zentral zum Stadtzentrum eine freie Brachfläche. Die Nutzung dieser Fläche blieb lange Zeit im Stadium eines Provisoriums. Häufige Eigentumswechsel zwischen 1948 und 1978 zeigen, dass es sowohl in der unmittelbaren Nachkriegszeit als auch in den darauffolgenden Jahrzehnten keinen „Masterplan“ für dieses Areal gegeben hat.
Wie oben ausführlich dargelegt, gingen die beiden Grundstücke Nr. 475, auf dem die Alte Synagoge stand sowie Nr. 475/1, auf dem sich einst das Gemeindehaus der Israelitischen Gemeinde befand, mit dem Vergleich vom 26.11.1948 nach einer vorläufigen Sperre der Militärregierung und der Anerkennung als „jüdisches Kulturvermögen“ an die Stadt Freiburg über. Die Stadt ebnete die beiden Grundstücke ein und ließ darauf zu Teilen einen Parkplatz errichten. [443] Dies schien sie in dem Bewusstsein zu tun, dass die Errichtung eines Parkplatzes den im Vergleich von 1948 genannten Auflagen nicht widersprach. Laut diesen Auflagen sollte der Platz, auf dem die Synagoge stand, nicht für Zwecke genutzt werden, die einer Profanierung gleichkämen. [444]
1950/51 ging ein Teil des Areals im Rahmen eines umfassenden Tausches zwischen der Stadt Freiburg und dem Landesfiskus (Universität Freiburg, Stiftungsvermögen) in den Besitz der Universität über: Mit Tauschvertrag vom 15. September 1950 vereinbarten Stadt und Universität die Abgabe einer Teilfläche der beiden Flurstücke von 800 qm an die Universität; für dieses Teilstück wurden 50,- DM pro Quadratmeter und damit ein Gesamtwert von 40.000,- DM veranschlagt.. [445] . Im Rahmen des Tauschvertrags wurde unter § 5 festgehalten, dass „das einzeln noch vorhandene Trümmermaterial [...] an das Eigentum der Erwerber [übergeht]“. [446] Außerdem sollten „sämtliche Ersatzansprüche aus der Kriegszerstörung oder –beschädigung der Anwesen auf den Tausch-Grundstücken (Sach- und Nutzungsschaden)“ bei den bisherigen Eigentümern der einzelnen Grundstücke verbleiben. [447]
In einem Nachtrag vom 23. Januar 1951 zum Tauschvertrag vom 15. September 1950 einigten sich Universität und Stadt Freiburg auf eine Veränderung der Flurstückszusammensetzung: Ddie beiden Flurstücke 475 und 475/1 wurden zu einem Flurstück 475 vereinigt und der Länge nach in einen westlichen Teil und einen östlichen Teil aufgeteilt. Demnach umfasste das im Besitz der Stadt Freiburg befindliche Flurstück 475 1519 qm als „Straßengelände“ entlang der westlichen Seite; das durch die Abtrennung entstandene neue Flurstück 475/2 der Universität umfasste als „Baugelände“ 800 qm entlang der östlichen Platzseite.
Das städtische Flurstück 475 wurde am 19. Oktober 1957 dann mit dem Straßenflurstück Werthmannplatz Nr. 335/1 vereinigt. [448]
Die Universität benötigte das Flurstück Nr. 475/2, um mit dem Bau des Kollegiengebäudes II beginnen zu können, das sich an der langen, östlichen Seite des Platzes erstrecktem sollte. Zwischen 1959 und 1961 wurde es schließlich durch den Architekten Otto Ernst Schweizer geplant und realisiert. [449]
Zehn Jahre später, am 11. September 1962, vereinigte die Universität insgesamt sieben in ihrem Besitz befindlichen Flurstücke, die alle nebeneinander lagen und deshalb eine Einheit bildeten, zu Nr. 474. [450] Darunter war auch das „Baugelände“ Nr. 475/2. Das auf diese Weise neu entstandene Flurstück ging in das Grundstockvermögen der Universität über.
Am 7. Januar 1963 ging eine kleinere, schmale Fläche des städtischen Flurstücks Nr. 335/1 durch einen Tausch von der Stadt Freiburg an das Land Baden-Württemberg über. [451] Davor wurde das Straßenflurstück 335/1 in unterschiedlich große Grundstücke geteilt. Es entstanden so die Flurstücke. Nr. 335/1 (Werthmannplatz), 335/4 (Anlagen) und 335/5 (Straßengelände). Das Flurstück Nr. 335/4, mit einer Fläche von 1,25 ar ging an das Land Baden-Württemberg über. Der Quadratmeterpreis wurde 1963 mit 200 DM,- angegeben.
Am 24. April 1964 übertrug die Universität Freiburg das Flurstück Nr. 474 sowie weitere Flurstücke aus ihrem Grundstockvermögen, auf welchen mitunter nun das neu erbaute Kollegiengebäude II stehen, an die Liegenschaftsverwaltung des Landes Baden-Württemberg. [452] In der Vorbemerkung heißt es zu Begründung:
„Das Land hat auf einem Teil der zum Grundstockvermögen der Universität gehörenden Grundstücke für Lehre und Forschung und Wohngebäude errichtet sowie die Bauunterhaltung und zum Teil die sonstigen Ausgaben getragen. Die Mieteinnahmen wurden teils von der Universität und teils von der Staatskasse eingezogen. Überschüsse aus den Mieteinnahmen der Universität waren an die Staatskasse abzuführen. Zur Bereinigung diese Verhältnisses vereinbaren die Vertragsteile die nachstehende Regelung.“ [453]
Unter § 1 wurde diese Regelung schließlich wie folgt fixiert:
„Die Universität überträgt unentgeltlich auf das Land Baden-Württemberg-Liegenschaftsverwaltung das Eigentum an den in der Anlage näher bezeichneten Grundstücken, die Lehr- und Forschungszwecken dienen.“ [454]
1967 veranlasste das Land Baden-Württemberg eine erneute eigentumsrechtliche Veränderung beim Grundbuchamt Freiburg: Insgesamt 20 Flurstücke, darunter auch das Flurstück Nr. 474 wurden am 3. Februar zu einem großen Gesamtflurstück vereinigt. Dieses neue Flurstück bekam die Nr. 445. [455]
1978 ist der bislang letzte Besitzerwechsel des ehemaligen Eigentums der Israelitischen Gemeinde verzeichnet. Am 10. Oktober kaufte die Stadt Freiburg einen Teil des Flurstücks Nr. 445 vom Land Baden-Württemberg ab. [456] Das betreffende Flurstück umfasste ca. 2.800 qm und wurde mit 345,- DM pro qm veranschlagt. [457] Daraus errechnete sich ein Kaufpreis von 966.000,- DM. Das Kaufflurstück sollte gemeinsam mit einem Teil des städtischen Flurstücks Nr. 335/1 zum Bau einer öffentlichen Tiefgarage verwendet werden. [458] Das an die Stadt verkaufte Flurstück entsprach ungefähr den beiden 1948 durch den Vergleich erhaltenen, ehemaligen Flurstücken Nr. 475 und Nr. 475/1, ergänzt um das an die Bertoldstraße angrenzende Eckflurstücks als nördlicher Begrenzung. [459]
Unter § 3, Abschnitt 7 des Kaufvertrags wurde vereinbart, dass die Käuferin zusichert „daß der Standort des sich auf dem Gelände befindlichen Mahnmals für die frühere jüdische Synagoge nur im Einvernehmen mit der Israelitischen Gemeinde Freiburg verändert werden darf.“ [460] Die geplante Tiefgerade wurde letztlich nicht realisiert, aber noch heute ist die Stadt Eigentümerin des Areals vor dem Kollegiengebäude II, dem heutigen Platz der Alten Synagoge. Wie das Gelände nach 1948 genutzt wurde, welche Ideen diskutiert wurden und welche Rolle die Erinnerung an die zerstörte Synagoge dabei spielte, soll im folgenden Kapitel näher erläutert werden.
6.2 Die Nutzung des Areals und das Aufkommen einer Gedenkkultur am Platz der Alten Synagoge
Bereits wenige Wochen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurden in der Freiburger Stadtverwaltung Überlegungen über einen möglichen Neubau der Synagoge angestellt. Dies belegen Aufzeichnungen aus dem Freiburger Stadtarchiv. So vermerkt das Amt des Oberbürgermeisters am 2. Juni 1945 in einer Aktennotiz: „Aus taktischen Gründen erscheint es notwendig, jetzt schon die Platzfrage für eine eventuell neuzubauende Synagoge zu klären.“ [461]
Diese Überlegungen, die noch vor der Gründung der neuen Israelitischen Gemeinde „aus taktischen Gründen“ angestellt wurden, wurden jedoch schnell wieder verworfen, bzw. nie zu einem Abschluss gebracht. Joseph Schlippe, der Freiburger Architekt, der unter dem nationalsozialistischen OB Kerber viele seiner an die NS-Ideologie angelehnten Bauten erfolgreich verwirklichen konnte, wurde 1945 ohne durch seine Tätigkeiten während der NS-Diktatur politischen Schaden genommen zu haben, von der französischen Militärregierung zum Leiter des Wiederaufbaubüros in Freiburg berufen. [462] Seine Funktion als Vorstand des städtischen Hochbauamtes behielt er von 1925 bis zu seinem Ruhestand im Jahr 1951 ununterbrochen inne. [463] Der Wiederaufbau des stark zerstörten Freiburg konnte auch auf der Grundlage des von Schlippe 1937 angefertigten Generalbebauungsplans für Freiburg erfolgen. Zum Neubau der Synagoge äußerte sich Schlippe am 12. Juli 1945 wie folgt:
„Die Platzwahl für eine zu erbauende Synagoge ist nicht leicht (...)
- Schon vor etwa 15 Jahren hat eine Denkschrift des Oberbaurats Lorenz eine Erweiterung des Kollegiengebäudes über den Synagogenbauplatz bis zum Löwenbräu vorgeschlagen. Vom gleichen Standpunkt aus hat der Unterzeichnende vor 8 Jahren ein Projekt ausgearbeitet, das das gleiche Gelände Universitätszwecken zuführen wollte. Wie das Modell meines damaligen Projektes zeigt [hier ist das für die Landesschau 1937 in Karlsruhe entworfene Modell gemeint, Vgl. Kapitel 4.1/S. 43 Anm. J.W.] , sollte der Erweiterungsbau aus den sofort zu nennenden Gründen eine ganz schlichte ruhige Fassade haben, den Hauptakzent sollte also nach wie vor auf dem Kollegienhaus liegen.
- Mehr noch als praktische führen architektonische Gründe zum gleichen Ergebnis: Eine neue Synagoge wird eine architektonische Dominante bilden, also einen Akzent, der gerade an dieser Stelle neben den vielen anderen öffentlichen Gebäuden kaum richtig zur Geltung käme.
[...]
Aus diesen beiden Gründen, besonders aus letzterem, lehnen wir den Gedanken eines Neubaus der Synagoge an der alten Stelle ab.“ [464]
Alternativ schlug Schlippe einen Neubau am ausgedehnten Baugebiet zwischen Fahnenbergplatz und Bismarckstraße vor, diese Pläne wurden jedoch nicht weiter verfolgt. [465] Auch nach 1945 war es – sehr wahrscheinlich auch aufgrund der personellen Kontinuitäten in den Ämtern nicht im Sinne der Stadt, die Synagoge an ihrem ursprünglichen Platz wieder zu errichten. Aus der Bemerkung Schlippes geht hervor, dass die schon vor 1945 angedachte Idee, das Gelände der Universität zur Verfügung zu stellen, nun endlich realisiert werden sollte. Das Areal, auf dem die Synagoge stand, war 1945 noch eine Brachfläche: Die Treppen und Anhöhen am westlichen Ende des Grundstücks waren laut Zeitzeugenberichten in der unmittelbaren Nachkriegszeit jedoch ebenso noch erhalten wie die Kellergeschosse der Synagoge. [466] Nach dem Abschluss des Vergleichs sollte das Gelände zunächst „provisorisch“ genutzt werden. Dazu legte die Stadt, wie oben beschrieben, einen Parkplatz an. Darüber hinaus wurden entlang der Werder- und Bertoldstraße einstöckige Behelfsläden errichtet. [467] Diese sollten den Zweck erfüllen, die schlechte Versorgungslage in der Stadt während der ersten Nachkriegsjahre zu mindern. Bereits kurz nach dem Abschluss des Vergleichs 1948 meldete sich die örtliche Niederlassung der Firma WMF als Interessentin für einen solchen Behelfsladen direkt bei der Israelitischen Landesgemeinde Südbaden und bat um „eine schriftliche Zusicherung, dass Ihrerseits der sofortigen Durchführung unseres Bauvorhabens kein Hindernis in den Weg gelegt wird.“ [468] Der Abschluss eines entsprechenden Vertrages mit dem Liegenschaftsamt sollte erfolgen, sobald „die mit Ihnen noch abzuschließende gütliche Vereinbarung getroffen ist.“ [469] Die WMF sicherte sich in diesem Fall bei der Israelitischen Landesgemeinde selbst ab, wohl, da die Modalitäten rund um den Vergleich, also die „gütliche Einigung“ noch nicht bekannt waren. Aus einem weiteren Schreiben, das im Zusammenhang mit diesen Behelfsbauten steht, geht hervor, dass die Bauplätze auf dem Synagogen-Gelände mithilfe einer „Fünfer-Kommission“ des Einzelhandelsverbands Südbadens in Rücksprache mit der Stadt Freiburg verteilt werden sollten. [470] Reaktionen von Seiten der Israelitischen Landesgemeinde sind darauf nicht überliefert.
Der Umgang des Platzes der Alten Synagoge im Freiburg der unmittelbaren Nachkriegszeit ist vergleichbar mit den Synagogenplätzen in anderen Städten und Ortschaften in den westdeutschen Besatzungszonen und der späteren Bundesrepublik. Ein Blick ins benachbarte Ihringen zeigt, dass das dortige Synagogengrundstück relativ schnell einem neuen Nutzen zugeführt werden sollte. So setzte sich die Spar- und Kreditbank Ihringen dafür ein, auf dem nun brachliegenden Areal ein „Lagerhaus, in welchem die zu erfassenden landwirtschaftl. Produkte higienisch [sic!] und einwandfrei gelagert werden können zu errichten [...]“. [471]
Dieser aus Ihringen dokumentierte geplante Umgang mit dem ehemaligen Synagogengrundstück ist in gewisser Weise typisch für eine pragmatische Nachnutzung von Synagogengrundstücken nach 1945 in der Bundesrepublik. In Baden-Baden wurde auf den Überresten der dort ebenfalls 1938 zerstörten und später abgerissenen Synagoge ein Parkplatz errichtet, nachdem das Grundstück im Jahr 1955 an Gesellschafter des Verlages des Badischen Tagblattes verkauft worden war. [472] Auch hier überging der Käufer damit eine Klausel im Kaufvertrag, in der es hieß, dass der Platz nicht zu „profanen Zwecken“ genutzt werden dürfe. [473] Erst 2018, als der Passus dieses Vertrags öffentlich wurde, hat dort eine wahrnehmbare kritische Diskussion um den Umgang mit der Geschichte des Platzes eingesetzt. [474]
In Mannheim wurde, wie oben bereits erwähnt, auf dem Grundstück der ehemaligen Hauptsynagoge ein Wohnhaus errichtet. Allerdings dachte die Stadt hier schon im Zuge der Restitution ernsthaft über einen Neubau und die Errichtung einer Gedenkstätte nach. [475] In Fellheim, einer kleinen Gemeinde nördlich von Memmingen im bayerischen Oberallgäu wurde die einzige, im Allgäu noch erhaltene, 1938 jedoch stark beschädigte Synagoge bis 1945 als Lagerhalle für Flugzeugmotoren, ab 1950 dann als Mietshaus in Privatbesitz genutzt. [476] Erst Anfang der 2000er Jahre, als ein Antrag für die Eröffnung einer Gaststätte im ehemaligen Synagogengebäude geprüft wurde, rückte es wieder in das Interesse der Öffentlichkeit. Die Gemeinde kaufte das Gebäude samt Grundstück 2007 ab und beauftragte den denkmalschutzgerechten Rückbau, damit das Gebäude wieder als Synagoge erkenntlich sei. [477] Heute dient die alte Synagoge Fellheim als Gedenk- und Bildungsort. In regelmäßigen Abständen finden dort Konzerte und kulturelle Veranstaltungen statt, auch um die Erinnerung an diesen Ort wach zu halten. [478] An dieser Stelle könnten noch viele weitere vergleichbare Beispiele aufgeführt werden. Die Anerkennung der Grundstücke als Gedenkorte setzte in vielen Orten erst Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein. In einigen Ortschaften erinnert heute nichts oder nur mehr wenig an die einstige Bedeutung dieser Grundstücke.
Auch die Stadt Freiburg tat sich in der Etablierung einer öffentlichen Gedenkkultur an die Geschichte der Alten Synagoge und damit auch an die Mitglieder der jüdischen Gemeinde schwer. Wie oben beschrieben, standen nach 1945 auch hier überwiegend pragmatische Erwägungen im Vordergrund. Zwischen 1959 und 1961 wurde, teilweise auf, teilweise angrenzend an einen Teil der einstigen, im Besitz der Israelitischen Gemeinde befindlichen Grundstücke das Kollegiengebäude II der Universität Freiburg errichtet, das am 26. Juni 1961 feierlich eingeweiht wurde. [479] Ein erster früher Anstoß hinsichtlich des Umgangs der Stadt mit der Geschichte des Platzes kam von Gertrud Luckner [480] , die 1953 die Verwendung des Platzes als Parkplatzes kritisierte. [481] Auch Stimmen aus dem Ausland, mitunter von ehemaligen jüdischen Gemeindemitglieder waren über die Tatsache, dass auf den Überresten der Alten Synagoge nun ein Parkplatz errichtet wurde und so gar nichts an die Synagoge erinnerte, erbost. Fanny Nathanson, ehemalige Freiburgerin, die nach 1945 in Liverpool lebte, schrieb am 29. Oktober 1953 einen Brief an die Stadt. In ihm brachte sie ihren Unmut und ihre Sorge zum Ausdruck, dass die Stadt Freiburg sich mit der Errichtung des Parkplatzes aus der Verantwortung stehlen und die nachfolgenden Generationen nicht über die Verbrechen der Nationalsozialisten aufklären würde. [482] In der Antwort, die sie wenige Tage später vom Oberbürgermeisteramt erhielt hieß es:
„Sehr geehrte Frau Nathanson!
Auf Ihren Brief vom 29.Okt. d.J. darf ich Ihnen mitteilen, dass in der Tat die Verwendung des früheren Synagogen-Platzes als Grünanlage in Aussicht genommen ist. Die augenblickliche Verwendung als Parkplatz ist nur eine provisorische. Sobald die Universität ihren Bau beendet haben wird (mit dem Bau soll Anfang des nächsten Jahres begonnen werden), soll die Grünanlage geschaffen werden.
Im übrigen darf ich bemerken, dass die jüdische Gemeinde Freiburg i. Br. selbst den früheren Synagogen-Platz gegen die Erbauung eines Empfangs- und Kultgebäudes am jüdischen Friedhof ausgetauscht hat. Ihr Vorwurf gegen die Stadtverwaltung lässt leider den Dank für alle Hilfe vermissen, die auf meine persönliche Anregung im Einvernehmen mit dem verstorbenen Herrn Rosenberger der jüdischen Gemeinde in Freiburg i. Br. zugewendet wurde, z.B. die gartenmäßige Errichtung des jüdischen Friedhofs und die vertragsmäßige Errichtung des Kultgebäudes. Nachdem der Synagogenplatz gegen ein anderes Kultgebäude ausgetauscht wurde, kann eine unwürdige Benützung des Platzes auch in der provisorischen Weise nicht erblickt werden. Wollte die jüdische Gemeinde Freiburg/Br. den Synagogenplatz als Platz einer „einstmaligen heiligen Stätte“ erhalten, dann hätte sie den Platztausch nicht vornehmen dürfen. Die Stadtverwaltung wird aber gerne bereit sein, bei Gelegenheit der Schaffung einer Grünanlage an der früheren Synagogenstelle eine Tafel aufzustellen, die auf das scheussliche Verbrechen des Synagogen-Brandes hinweist. Wir, die ebenfalls Naziverfolgte gewesen sind, werden uns hüten, die jüdischen Gefühle zu verletzen.
Ich hoffe, dass Ihnen meine Zeilen eine Beruhigung bedeuten werden.
Mit verbindlichen Grüßen verbleibe ich
Ihr O.B. Abt. I“ [483]
In diesem Schreiben tritt noch einmal deutlich zutage, dass die Nutzung als Parkplatz in den Augen der Stadt offenbar keinen „profanen Zweck“ darstellte und diese Art der Nutzung als Provisorium angesehen werden sollte. Gleichzeitig wird die Verantwortung für einen würdevollen Umgang mit dem Platz indirekt an die Israelitische Gemeinde abgegeben, die mit der Entscheidung, dem Vergleich zuzustimmen, diese Entwicklung selbst herbeigeführt hätte. Letztlich bleibt die Ankündigung, eine Gedenktafel zu errichten, sehr vage. Zu diesem Zeitpunkt scheint die Stadt solche Erwägungen entweder ohne eine längerfristige Planung oder als reine Lippenbekenntnisse geäußert zu haben. Noch im September 1953 hieß es in einem internen Vermerk des Bürgermeisteramts, Abt. III, nämlich: „Das ehemalige Synagogengelände wurde vor einiger Zeit enttrümmert und zu einem Parkplatz hergerichtet. Im Zuge des Ausbaus des Ringes wird dieses Gelände als Straßengelände benötigt. Das Bürgermeisteramt – Abt. III.“ [484]
Eineinhalb Jahre nach der Fertigstellung des Kollegiengebäudes II konnte dennoch eine Gedenkplatte errichtet werden. Diese wurde am 11. November 1962 enthüllt und der Öffentlichkeit präsentiert. [485] Sie enthielt die vorab mit der Israelitischen Gemeinde abgesprochene Inschrift: „Hier stand die Synagoge der Israelitischen Gemeinde Freiburg, erbaut 1870. Sie wurde am 10. November 1938 unter einer Herrschaft der Gewalt und des Unrechts zerstört.“ Entworfen wurde sie von dem Freiburger Bildhauer Karl Rißler. Nachdem sich einige Jahre zuvor schon (ehemalige) Bürgerinnen und Bürger der Stadt Freiburg dafür eingesetzt hatten, war die finale Initiative zur Errichtung dieser Gedenkplatte auf einen Vorschlag von Stadtrat Murmann zurückzuführen, der sich im Juli 1959 mit einer Notiz an Oberbürgermeister Joseph Brandel wandte:
„Ich bin der Ansicht, dass am Neubau der Universität ein Schild daran erinnern sollte, dass auf diesem Gelände früher die Synagoge stand. Vielleicht ist es zweckmäßig, dass die Stadtverwaltung an die Universität mit diesem Wunsch herantritt. [...]“ [486]
Die Stadt trat nur wenige Monate später mit diesem Vorschlag an die Universität heran. Der Senat der Universität stimmte dem Vorhaben mit großer Bereitwilligkeit zu und brachte die Idee auf, die Platte nicht wie zunächst vorgesehen in die Außenwand des Neubaus zu integrieren, sondern an der Stelle in den Boden einzulassen, an der die Synagoge tatsächlich gestanden hatte. [487] Eigentlich sollte die Platte zur Einweihung des neuen Kollegiengebäudes II fertiggestellt sein. Nachdem zwischen den beteiligten Akteuren jedoch deutlich mehr Abstimmungsbedarf erforderlich war als angenommen, konnte die Gedenkplatte erst Ende 1962 fertiggestellt und enthüllt werden.
Nachdem es 1964, u.a. aus der Israelitischen Gemeinde Freiburg Beschwerden über die unzureichende Sichtbarkeit der Gedenkplatte gegeben hatte, wurde sie nach einigen Veränderungsmaßnahmen auf einen Sockel gehoben und dadurch erhöht. [488] Die so entstandene, neue Form der Gedenkplatte wurde am 9. November 1966 enthüllt. [489] Unabhängig von dieser Gedenkplatte hatte der Herder-Verlag zwei kleinere Tafeln gestiftet, welche dieser unmittelbar neben der Gedenkplatte an die Synagoge anbringen ließ. Auf den Tafeln wurde auf etwas widersprüchliche Weise der Bewahrung von Stadt und Münster in der Bombennacht vom November 1944 gedankt sowie der Synagoge gedacht. [490]
Der Name des Platzes änderte sich nach 1945 mehrmals, so dass sich auch daran seine wechselhafte Bedeutung ablesen lässt. Von 1945 bis 1984 firmierte er unter dem Namen „Werthmannplatz“, benannt nach dem Gründer der Caritas, Lorenz Werthmann. Diesen Namen hatte der Platz auch schon zwischen 1927 und 1939 gehabt. Nach 1939 wurde der Werthmannplatz jedoch als Platz aufgelöst und in die Werder- bzw. Rotteckstraße umgewandelt. [491] Ab 1984 gab es zwei unterschiedliche Namen für das Areal vor dem Kollegiengebäude II. Das nördliche Areal zwischen Bertold- und Sedanstraße wurde in „Europaplatz“ umbenannt, während der südliche Teil zwischen Sedan- und Belfortstraße den Namen „Werthmannplatz“ behielt. Erst 1996 wurde der „Europaplatz“ in „Platz der Alten Synagoge“ umbenannt, eine Maßnahme, die nach Ansicht des Kunsthistorikers Peter Kalchthaler sowie des Journalisten Joachim Röderer schon viel früher hätte erfolgen müssen. [492] Der südliche „Werthmannplatz“, zwischen Universitätsbibliothek und Kollegiengebäude I wurde zum Universitätsjubiläum 2007 in „Platz der Universität“ umbenannt. Die ehemalige, südlich daran angrenzende „Werderstaße“ firmierte von da an als „Werthmannstraße“, um dem Caritas-Gründer nach wie vor ein Straßennamen-Denkmal widmen zu können. [493]
Da außer der Gedenkplatte und dem 1996 geänderten Platz-Namen in der Innenstadt Freiburgs nur wenig an das Schicksal der Freiburger Jüdinnen und Juden erinnerte, initiierte eine Künstlergruppe gemeinsam mit Freiburger Bürgerinnen und Bürgern im Jahr 2000 die Er- und Aufstellung eines Ortsschildes mit der Aufschrift „Gurs – 1027 km“, das auf dem Platz der Alten Synagoge angebracht wurde. [494] Dieses Mahnmal, das an die Deportation der Freiburger Juden nach Gurs erinnern soll, wurde nachträglich von der Stadtverwaltung genehmigt. Im Rahmen der Umbaumaßnahmen ab 2016 musste das Schild kurzzeitig eingelagert werden. Nach einer Diskussion um den neuen Standort wurde es 2018 schließlich nahe des Standorts der Alten Synagoge angebracht und eine erläuternde Tafel dazu in den Boden eingelassen. [495]
Während sich am Standort der Alten Synagoge sehr langsam eine schwach erkennbare Form von Erinnerungskultur an die Geschichte des Ortes etablierte, konnte der Bau einer neuen Synagoge erst Mitte der 1980er Jahre umgesetzt werden. Dafür überließ die Stadt Freiburg der Israelitischen Gemeinde bereits im Jahr 1971 unentgeltlich einen Bauplatz in der Stadtmitte, unweit des Münsterplatzes, an der Straßenecke Nußmannstraße 14 / Engelstraße. [496] Das Grundstück wurde damals auf einen Wert von 760.000 DM geschätzt. [497] Für den insgesamt rund zehn Millionen teuren Bau steuerte die Stadt zusätzlich eine Million, das Land Baden-Württemberg drei Millionen D-Mark bei. Die neue Synagoge konnte 1987 feierlich eröffnet werden. Die in der Pogromnacht geretteten Eichenportale aus der Alten Synagoge wurden als Eingangstüren in die neue Synagoge integriert. Im November 2017 konnte die Israelitische Gemeinde das 30-jährige Bestehen der Neuen Synagoge feiern. [498] Im Jahr 2018 ging die Synagoge schließlich auch notariell in den offiziellen Besitz der Israelitischen Gemeinde Freiburg über, nachdem sie zuvor Eigentum der Israelitischen Religionsgemeinschaft Badens als dem übergeordneten Dachverband gewesen war. [499] 80 Jahre nach der Zerstörung im November 1938 hat die Israelitische Gemeinde auf diese Weise erstmals wieder eine eigene Synagoge in ihren Besitz nehmen können. Dass die Erinnerung an die Geschichte dieser Gemeinde und die zahlreichen Opfer, die sie forderte, aber äußerst fragil und nicht selbstverständlich ist, zeigen die Diskussionen um den Umbau des Platzes der Alten Synagoge, die bis in die Gegenwart im Jahr 2019 sehr emotional geführt werden.
7. Erinnerung, Kontroverse, Vermächtnis – Der Platz der Alten Synagoge im Jahr 2019
„Die Moderne hat grundsätzlich zwei Seelen in der Brust: den Drang nach Abriss und den nach Konservierung. Das Pendel schwingt zwischen diesen beiden Polen hin und her und der Ausgleich zwischen beiden Extremen ist nicht leicht zu finden.“ [500]
Diese Worte der Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann, die sie gebraucht, um das Spannungsfeld zwischen Geschichte und Gedächtnis sowie des menschlichen Umgangs damit zu beschreiben, spiegeln die jüngste Debatte um den Umgang mit dem Platz der Alten Synagoge in Freiburg in Teilen sehr gut wider. In den vergangenen zehn Jahren wurde die Nutzung und Umgestaltung des Platzes zum Gegenstand einer breiten, auch überregionalen Diskussion um den „richtigen Umgang“ mit der Geschichte dieses Ortes und der Erinnerung daran. Die Grundzüge dieser Entwicklung seien im Folgenden überblicksartig zusammengefasst.
Im Jahr 2006 lobte die Stadt Freiburg einen Realisierungswettbewerb für die künstlerische und planerische Umgestaltung des Platzes der Alten Synagoge aus. [501] Längerfristige Überlegungen hatten im Vorfeld zu der Erkenntnis geführt, dass der zentrale Platz in unmittelbarer Nachbarschaft zu Universität, Stadttheater, Hauptbahnhof und Innenstadt nicht optimal genutzt wird. Er sollte deshalb zu einem verkehrsberuhigten Ort der Begegnung ausgebaut werden. Die stadtplanerischen Veränderungen sahen vor den Rotteckring (früher Werderstraße), der den Platz seit 1876 westlich begrenzte, lediglich noch für den öffentlichen Nahverkehr, für Fußgänger und Radfahrer freizugeben. In einer Vereinbarung zwischen der Stadt Freiburg als Eigentümerin des Flurstücks Nr. 445/6 und der Universität als direkter Anrainerin des Platzes der Alten Synagoge wurde festgehalten: „Im Zuge des Gesamtvorhabens ist vorgesehen, den Platz der Alten Synagoge als attraktiven Stadtplatz neu zu gestalten“ [502] . Im Siegerentwurf für die architektonische Umgestaltung, den die Arbeitsgemeinschaft faktorgruen Landschaftsarchitekten und Volker Rosenstiel (Architekt) eingereicht hat, sollte der Platz eingeebnet und über die fast komplette Fläche begehbar gemacht werden. In einer die direkte Umsetzung betreffenden Vereinbarung zwischen Universität und Stadt Freiburg heißt es ferner:
„Die aus dem Wettbewerbsbeitrag weiter entwickelte Entwurfsplanung sieht vor, im südöstlichen Platzbereich mit dem glatten Wasserspiegel im Grundriss der zerstörten Synagoge und mit maßvoller Baumbepflanzung eine ruhige Atmosphäre vor dem Kollegiengebäude II zu schaffen, während im Vorbereich des Theaters mit bewegten Wasserelementen und angrenzenden Gastronomie [...] deutlich lebhaftere Nutzungen zu erwarten sind.“ [503]
Ein wesentliches Element des neuen Platzes sollte demnach ein Wasserspiegel auf der Grundfläche der Alten Synagoge sein. Eine 2004 einberufene Planungswerkstatt arbeitete bereits heraus, dass der neue Platz auch ein „Ort des Erinnerns“ werden sollte, der ein „temporäres Gedenken“ ermöglicht. [504] Der Entwurf sollte das „Sichtbarmachen der ursprünglichen Synagoge im Stadtraum“ thematisieren, den Platz aber nicht zu einer Mahn- oder Gedenkstätte machen. [505]
Das Vorhaben, auf den Grundrissen der Alten Synagoge einen Wasserspiegel anzulegen, wurde in der Folge sehr kritisch diskutiert, der siegreiche Entwurf immer wieder verändert. [506] Die Bauarbeiten für die Umbaumaßnahmen begannen dennoch im Juni 2015. Am 18. April 2016 erfolgte der offizielle Spatenstich. [507]
Im September 2016 stießen Arbeiter bei der Aushebung der Erde zur Errichtung des Synagogenbrunnens auf Fundamente, die mitunter der Alten Synagoge zugeordnet werden konnten. Ein sofort verhängter, vorübergehender Baustopp ermöglichte die Begutachtung der Fundamentreste sowie die Anfertigung eines mineralogischen Berichts zum Zustand der aufgefundenen Steine. Das Gutachten attestierte eine ungewöhnlich schlechte Qualität der Steine. [508] Ohne eine schützende Umgebung könnten sie nicht weiter verbaut oder ausgestellt werden. Die Stadt erließ deshalb die Entscheidung, einen Teil der Steine abzutragen und zunächst beim Tiefbauamt einzulagern. Fundamentreste, die nicht ohne weiteres abgetragen werden konnten, wurden unter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten versiegelt. [509] Die neuen Fundamente für den Wasserspiegel wurden daraufhin auf den noch vorhandenen Überresten der Original-Steine errichtet. Die Entscheidung, die Umbauarbeiten wie geplant weiterzuführen rief in der Öffentlichkeit sowie bei der Israelitischen Gemeinde in Freiburg großes Unverständnis bis zu teilweise harscher Kritik hervor. [510] Noch vor der offiziellen Übergabe des Platzes an die Freiburger Öffentlichkeit beschloss der Stadtrat deshalb die Durchführung eines Dialogverfahrens, an dem neben der Israelitischen Gemeinde Freiburg auch die Liberale Jüdische Gemeinde Freiburg teilnehmen sollte. [511]
Unmittelbar nach der Übergabe des Platzes an die Öffentlichkeit am 2. August 2017, trat für die Betroffenen aus den jüdischen Gemeinden ein neues, schmerzhaftes Problem zutage: Wie schon im Vorfeld zu erwarten war, wurde der Gedenkbrunnen in den heißen Sommertagen als „Planschbecken“ zur Abkühlung sowie auch zur Kühlung von Getränken verwendet. [512] An die Geschichte des Ortes erinnerte zu dieser Zeit lediglich die aus den 1960er Jahren stammende Gedenkplatte, die im Zuge der Umbaumaßnahmen entfernt und anschließend in den Boden des Wasserspiegels eingelassen wurde. Die Inschrift ist unter der Wasseroberfläche von außen nur schwer erkennbar, was dazu führte, dass die Besucher den Brunnen nicht nur betraten, sondern auch arglos über die Gedenkplatte liefen. [513] Dass diese Bilder bei den jüdischen Gemeinden in Freiburg und darüber hinaus für Empörung sorgten, erscheint vor dem Hinblick der bewegten Geschichte des Ortes nachvollziehbar. Im von der Stadt organisierten Dialogverfahren standen vor diesem Hintergrund nun unterschiedliche, teilweise höchst emotionale Themen und Bedürfnisse auf der Agenda. [514] Im Rahmen des über mehrere Monate laufenden Verfahrens, das extern moderiert wurde, konnten einige wichtige Teilschritte für konkrete Maßnahmen vereinbart werden. Aufgrund der schlechten Beschaffenheit der Steine wurde davon Abstand genommen, die Steine in einem ergänzenden Mahnmal auf dem Platz oder außerhalb der Neuen Synagoge auszustellen. [515] Um dennoch einen Ort zu haben, an dem würdig an das Schicksal der Synagoge und damit auch an das der Juden in Freiburg erinnert werden kann, fassten die Beteiligten den Aufbau eines NS-Dokumentationszentrum mit einem integrierten Gedenkort ins Auge. [516] In diesem Rahmen sollten auch die abgetragenen und eingelagerten Fundamente der Synagoge einen würdigen Platz finden.
Weitere wichtige Ergebnisse aus dem Dialogverfahren bestanden mitunter in der dauerhaften Aufstellung von Informationstafeln am Wasserspiegel, das Sicherstellen und Ermöglichen eines würdigen „temporären Gedenkens“ am Synagogenbrunnen, zum Beispiel zu Gedenktagen sowie ein vom Garten- und Tiefbauamt auszuarbeitendes Konzept über die adäquate Lagerung der Fundament-Steine der Alten Synagoge bis zu deren Integration in das NS-Dokumentationszentrum. [517]
Weitere, im Mai 2019 beschlossene Maßnahmen durch den Gemeinderat sind die Erarbeitung einer digitalen Informationsstelle mit Informationen zu Geschichte und Gegenwart der jüdischen Gemeinden in Freiburg, Piktogramme, die an einen würdigen Umgang mit dem Synagogenbrunnen erinnern sowie ein 3D-Modell der Alten Synagoge aus Bronze, das neben dem Brunnen aufgestellt werden soll. [518] Zudem soll ein Zonierungsband aus Metall verlegt werden, um das Areal rund um den Synagogenbrunnen besser als Ort der Erinnerung kennzeichnen zu können. Das Band wird die Inschrift „Zachor“, hebräisch für „Erinnere dich“, in acht unterschiedlichen Sprachen enthalten. [519]
Diese Maßnahmen sowie die davon begleiteten Diskussionen bieten die Chance, eine langfristige und lebendige Kultur der Erinnerung in Freiburg zu etablieren und sich dabei kritisch wie zukunftsgewandt mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Bestmögliche Transparenz sowie das Bemühen darum, Zukunft gemeinsam zu gestalten ohne dabei die Geschichte der NS-Zeit und ihre Opfer zu vergessen, muss der langfristige Auftrag der Stadt und ihrer Gesellschaft sein.
8. Zusammenfassung und Schlussbetrachtung
Die vorliegende Arbeit ist der Versuch, auf drängende Fragen, die sich bei der Rekonstruktion der Geschichte der Alten Synagoge Freiburg auftun, Antworten oder zumindest Annäherungen zu finden. Dies war ein besonderes Anliegen der Stadt Freiburg, die um mehr Transparenz und einen verantwortungsbewussten Umgang mit ihrer teilweise sehr schmerzhaften Vergangenheit bemüht ist. Im Zentrum der hier behandelten Fragestellung stand die Nachzeichnung der „Arisierung“ des Synagogengeländes nach der Zerstörung der Synagoge am 9./10. November 1938 ebenso wie die nach 1945 initiierte Restitution für die beiden Grundstücke. Die Betrachtung sollte aus eigentumsrechtlicher Perspektive erfolgen und damit verbundene Aspekte wie Eigentumsverhältnisse, Besitzerwechsel sowie deren Hintergründe und Konditionen beleuchten. Die Darstellung erfolgte unter Einbezug übergeordneter historischer Prozesse, wie der Beschreibung der „Arisierungsvorgänge“ in Baden und auf Reichsebene, oder der bereits dokumentierten Entwicklung in anderen Städten, wie Mannheim, Köln oder Krefeld, um Parallelen und Unterschiede benennen zu können. Eingebettet wurden diese Aspekte in eine überblicksartige, chronologische Darstellung der Geschichte der Alten Synagoge, die eng mit der Geschichte der Israelitischen Gemeinde in Freiburg selbst verbunden ist.
Jüdisches Leben ist in Freiburg erstmals im 13. Jahrhundert nachgewiesen. Im Gefolge der Pestepidemie des 14. Jahrhunderts waren auch die Freiburger Juden verfolgt, vertrieben und auf dem Höhepunkt der antijüdischen Ausschreitungen auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Über 400 Jahre lang hatte es daraufhin keine kontinuierliche Ansiedlung von Juden in Freiburg mehr gegeben. Erst ab 1864 wird jüdisches Leben durch die Gründung der Israelitischen Gemeinde zu einem festen Bestandteil der Freiburger Gesellschaft. Dieser Errungenschaft steht die Tatsache gegenüber, dass die Geschichte der Juden in Freiburg zu großen Teilen von Diskriminierung, Ausgrenzung, Entrechtung und Verfolgung bis hin zum systematisierten Massenmord geprägt war. Die untersuchten Akten wiesen in vielen Fällen Vorgänge auf, die ein durchaus nicht ungetrübtes Verhältnis zwischen der Stadt Freiburg und der Israelitischen Gemeinde belegen. Vorbehalte der christlichen Freiburger Mehrheitsgesellschaft gegenüber den jüdischen Bürgern waren schon vor 1933 erkennbar und spiegelten sich zum Beispiel in den Gleichstellungsverhandlungen bis 1864 oder in den Korrespondenzen über den Anbau an die Synagoge zu Beginn der 1920er Jahre wider.
Dennoch konnte sich die Israelitische Gemeinde relativ bald nach ihrer Gründung zu einer selbstbewusst werdenden jüdischen Gemeinde etablieren, die rasch anwuchs und die Notwendigkeit eines Synagogenbaus formulierte. Auch wenn der Bau der Synagoge von städtischer Seite nicht ausschließlich von Wohlwollen begleitet war, wurde sie in den ersten Jahren nach ihrem Bau in Freiburg als architektonische wie gesellschaftliche Errungenschaft gefeiert. Doch bereits wenige Jahren nach dieser, für die jüdische Gemeinschaft in Freiburg sehr positiven Entwicklung, wuchsen unter dem Einfluss der erstarkenden Nationalsozialisten die Anfeindungen und das Misstrauen gegenüber den Juden wieder an.
Ab 1933 waren sie auf der Grundlage rasch geänderter Gesetze sukzessive vom öffentlichen Leben ausgeschlossen, entrechtet und um ihr Eigentum beraubt worden. Einen grausamen Höhepunkt dieser Entwicklung bildete in der Nacht von 9. auf 10. November 1938 die Zerstörung der Freiburger Synagoge. Die verbrecherischen Taten, die in dieser Nacht gegen Juden und ihre Synagogen in ganz Deutschland verübt wurden, dienten der NS-Führung in der Folge als zusätzliche Legitimation, um noch unmenschlicher und grausamer gegen die jüdische Bevölkerung vorzugehen. Im Zuge der allerorts stattfindenden „Arisierungsvorgänge“ von jüdischem Eigentum erwarb auch die Stadt Freiburg mehrere jüdische Grundstücke. Darunter 1939 auch die beiden Grundstücke, auf welchen die Synagoge und das jüdische Gemeindehaus standen. Der Verkauf der Grundstücke erfolgte für die Israelitische Gemeinde unter Zwang. [520] Vorhandene Akten belegen, dass die Stadt schon seit vielen Jahren auf diese Grundstücke spekuliert hatte, um das schmucke Areal neben Universität und Stadttheater für repräsentative Bauten und Straßenerweiterungen nutzen zu können. Über den Kaufpreis für diese Grundstücke konnte die Gemeinde nicht mehr frei verfügen, da dieser auf ein Sperrkonto eingezahlt werden musste. Was mit dem Kaufpreis letztlich geschah, bzw. wann und unter welchen Umständen er „verwertet“ wurde oder dem Reich „verfallen“ ist, waren zentrale Fragen der hier vorliegenden Arbeit.
Aufschlussreiche Einsicht konnte die Autorin in diesem Zusammenhang mithilfe der Israelitischen Gemeinde Freiburg in die Akten des historischen Archivs der Deutschen Bank Frankfurt nehmen. Die dort noch vorhandenen Kontodaten der Israelitischen Gemeinde wiesen keine Transaktion der Kaufsumme für das Synagogenareal auf. Dieser Umstand lässt vermuten, dass die Unterlagen des Kontos, auf das die Kaufsumme 1939 einbezahlt wurde, zwischen 1939 und 1945 vernichtet wurden oder in den Kriegswirren abhanden gekommen und deshalb heute nicht mehr nachweisbar sind. Aufgrund der ab 1940 gängigen Praxis, jüdisches Gemeindevermögen nicht direkt zu „verwerten“, also der Reichskasse zuzuführen, sondern es der Verwaltung durch die „Reichsvereinigung der Juden“ zu überlassen, ist es als wahrscheinlich anzusehen, dass das Vermögen der Israelitischen Religionsgemeinschaft Freiburg über diesen Weg eingezogen und für deren Zwecke genutzt wurde.
Die Israelitische Gemeinde Freiburg galt mit der Deportation ihres letzten Vorsitzenden, Nathan Rosenberger, im August 1942 nach Theresienstadt als aufgelöst. [521]
Er und seine Frau Martha kamen als eine der wenigen Überlebenden 1945 nach Freiburg zurück. Rosenberger gründete gemeinsam mit anderen (wieder) in Freiburg lebenden Juden bereits im Dezember 1945 eine neue jüdische Gemeinde in Freiburg und setzte sich mit großem Engagement für deren Etablierung ein.
In den Prozessen der Restitution ging die nach 1945 neu gegründete Israelitische Landesgemeinde Südbaden in Freiburg einen Vergleich mit der Stadt Freiburg ein, der den Verzicht auf die innenstadtnahen Grundstücke bedeutete. Im Gegenzug verpflichtete sich die Stadt zum Bau eines Wärter- und Leichenhauses am jüdischen Friedhof sowie zu dessen Wiederherstellung und Einfriedung. Eine Entschädigung für die 1938 zerstörte Synagoge wurde im Rahmen dieser „Gütlichen Vereinbarung“ nicht verhandelt. Die nach 1945 ausgemachten Haupttäter, die den Brand der Synagoge mit zu verantworten hatten, konnten nicht mehr juristisch belangt werden, da sie vor 1945 gefallen waren oder als vermisst galten. Die an der Brandstiftung noch identifizierten Beteiligten wurden zu marginalen Strafen verurteilt. Verantwortung für die zerstörte Synagoge hat die Stadt in diesem Zusammenhang erst relativ spät übernommen. 1971 überließ sie der jüdischen Gemeinde unentgeltlich ein Grundstück nahe des Münsterplatzes, auf das bis 1987 die neue Synagoge Freiburg gebaut werden konnte. In die neue Synagoge konnten die 1938 geretteten eichenen Portale aus der Alten Synagoge sowie ein ebenfalls geretteter Lüster integriert werden. Die Stadt beteiligte sich am Neubau zusätzlich mit einer Million D-Mark.
Die schmerzhafte jüdische Geschichte der Stadt Freiburg ist heute Gegenstand zahlreicher teilweise sehr emotional geführter Diskussionen und Debatten. Dem Wunsch nach einem offenen und niedrigschwelligen Umgang mit dem Platz der Alten Synagoge steht der Wunsch nach würdigem Gedenken, Anerkennung des Leids sowie nach größerer Verantwortungsübernahme durch die Stadt Freiburg gegenüber. Die Stadt Freiburg hat sich der Verantwortung gegenüber ihrer Geschichte erst spät gestellt. Damit bildet sie keine Ausnahme, sondern steht vielmehr in einer Reihe mit zahlreichen westdeutschen Städten, deren Politik nach 1945 vor allem auf Wiederaufbau, Neubeginn und Verdrängung ausgerichtet war. Zu Beginn waren es die Hinterbliebenen der Opfer und die Überlebenden unter den NS-Verfolgten selbst, die sich um die Restitution und ihre gesellschaftliche Wiedereingliederung kümmerten. Den Rahmen dafür boten die Gesetze der alliierten Militärregierungen. Erst mit der Entschädigungsgesetzgebung der späten 1940er Jahre und nach Gründung der Bundesrepublik setzte auch eine „Wiedergutmachung“ auf staatlicher Ebene ein. Der öffentliche Umgang mit der Geschichte des Nationalsozialismus und seiner Opfer sollte noch lange im Verborgenen bleiben. In den 1960er Jahre sind in Freiburg mit der Errichtung einer Gedenkplatte an die Alte Synagoge schließlich zarte Ansätze einer einsetzenden Erinnerungskultur zu erkennen. Die Diskussionen um die „richtige“ Form des Erinnerns sind heute nicht weniger kontrovers als vor knapp 60 Jahren. Der Konflikt um das sogenannte Planschbecken auf dem Platz der Alten Synagoge ist auch im Mai 2019 noch nicht beigelegt. [522] Die Maßnahmen und Gespräche der Zukunft werden zeigen, ob die Stadt Freiburg sowie alle weiteren, an diesen Prozessen beteiligten Akteure, zu einem maßvollen und langfristigen Konzept einer eigenen Erinnerungskultur finden werden, das Aushängeschild und Vorbild für andere Städte zugleich sein kann.
Im Rahmen der vorliegenden Recherche-Arbeit, die einen Zeitraum von knapp neun Monaten umfasste, wurden zahlreiche Quellen gesichtet und ausgewertet, die bislang nicht in wissenschaftliche Arbeiten Eingang gefunden haben. Belege über den Verbleib der Kaufsumme für das Synagogenareals von 1939 konnte die Autorin darin nicht finden. Zwar zeichnen sich durch die Rekonstruktion der Vorgänge höhere Wahrscheinlichkeiten hinsichtlich der „Verwertung“ der Summe zugunsten der „Reichsvereinigung der Juden“ ab, abschließend beweisen lässt sich diese Annahme auf Grundlage des eingesehenen Aktenmaterials jedoch nicht.
Zukünftige wissenschaftliche Arbeiten könnten sich neben dieser offen gebliebenen Frage schließlich auch vertieft mit der Geschichte der jüdischen Gemeinden in Baden, mit ihren Synagogen und ihrer öffentlichen Wahrnehmung in divergierenden historischen Kontexten befassen. Ferner erscheint die Untersuchung lokaler Erinnerungskulturen und die auf dieser Basis erkennbaren sozialen wie politischen Begebenheiten ein lohnenswertes wissenschaftliches Feld zu sein.
9 Anhänge
Anlage 1 – Abbildungen
Abb. 1: Die Freiburger Synagoge im Jahr 1902, Stadtarchiv Freiburg M736-1772.

Abb. 2: Gottlieb Theodor Hase: Werderstraße mit Alleegarten, im Hintergrund (v. r. n. l) ein Nebengebäude der Rempartkaserne, die Synagoge, das Bertoldgymnasium und das Rotteck-Gymnasium (nach 1876), gemeinfrei über Wikicommons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gottlieb_Theodor_Hase_63308705.jpg (letzter Aufruf: 23.05.2019) .

Abb. 3: Aufnahme der Synagoge nach dem Erweiterungsbau von 1925, hier in Richtung Osten fotografiert um 1930, Stadtarchiv Freiburg, M 70S_201-27. Nr. 11-33.

Abb. 4: Aufnahme der zerstörten Synagoge von Josef Vollmer, beschriftet mit „12.11.1938“, Stadtarchiv Freiburg.

Abb. 5: Platz der Alten Synagoge mit Universitätsbibliothek, Blick vom KG II, aufgenommen von Andreas Schwarzkopf am 4. August 2017, Wikicommons, abzurufen über: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Platz_der_Alten_Synagoge_in_Freiburg,_Synagogenbrunnen_mit_der_Universitätsbibliothek,_Blick_vom_KG_II.jpg), „Platz der Alten Synagoge in Freiburg, Synagogenbrunnen mit der Universitätsbibliothek, Blick vom KG II“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode (letzter Aufruf: 29.07.2019).

Anlage 2 – Skizze über die Eigentumsverhältnisse auf dem Platz der Alten Synagoge von 1868 bis 1978
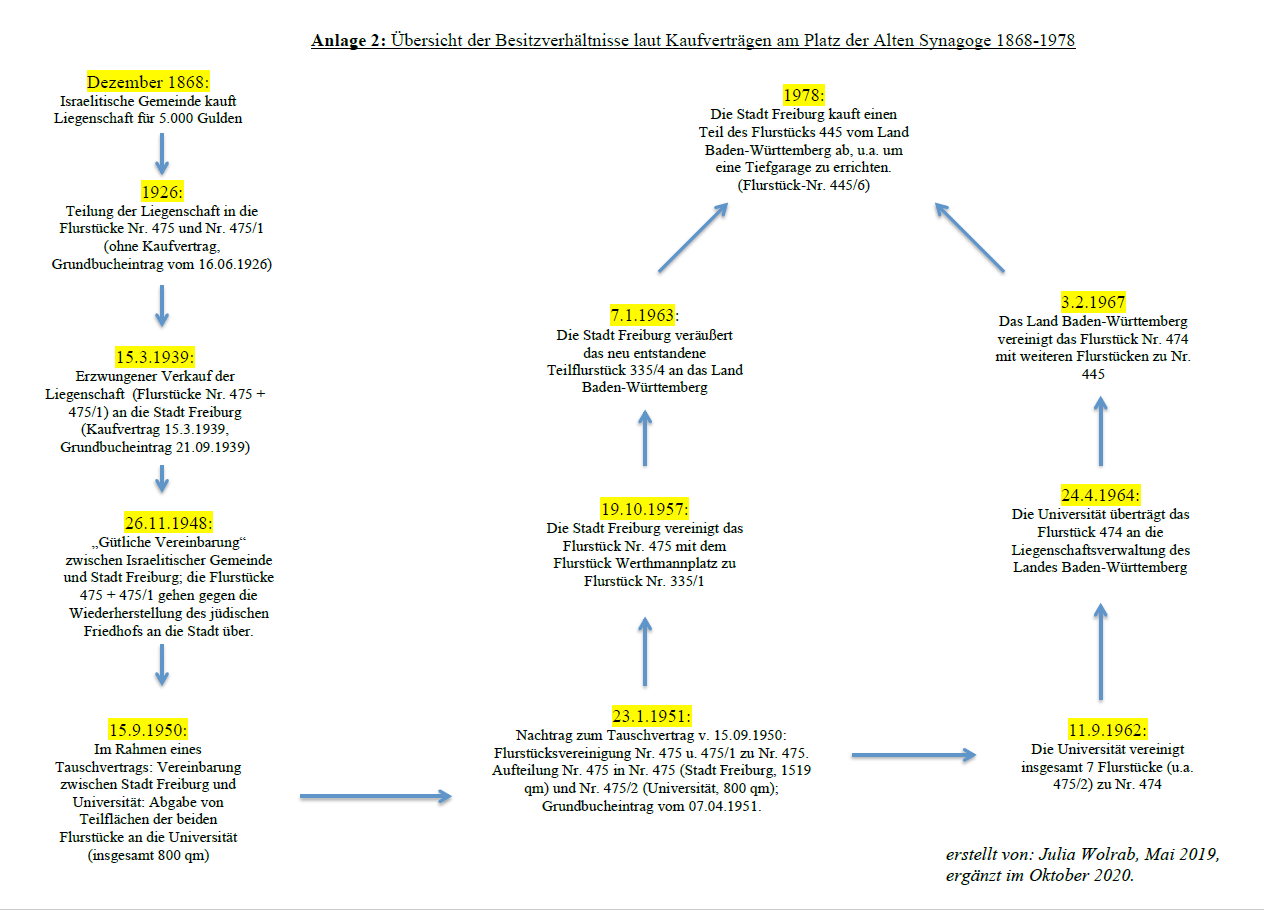
10. Quellen- und Literaturverzeichnis
Verwendete Quellen
Stadtarchiv Freiburg:
B5 IIIa Nr. 100 (alte Nr. 47), Grundbuch 1868-1870
Erwerb der Liegenschaft durch die Israelitische Gemeinde 1868/69
C2/75/1 Judensachen
C3/20/3 Synagoge an der Werderstraße
C4/I/16/10 Synagoge
C4/I/19/03 private Bausachen, Baugesuch an der Bertoldstr. 42/44 Werthmannplatz/Löwenbrauerei
C4/II/6/8 Festhalle
C4/VII/12/5 Gemeindevermögen, Ankauf von Grundstücken
C4/XII/28/6 Anlage eines Parkplatzes auf dem früheren Synagogengelände
C5/2471 Synagoge
C5/4355 Israelitischer Friedhof
D.Ti 437 Sammlung von Situationsplänen Werderstraße
Biographische Datenbank Freiburger Jüdinnen und Juden 1933 – 1945
Staatsarchiv Freiburg:
F 166/3 965 Israelitische Landesgemeinde Südbaden, Freiburg, 1948-1949
F 176 /1 Staatsanwaltschaft Freiburg, juristische Aufarbeitung Synagogenbrand
F 196/1 Landesamt für Wiedergutmachung, Außenstelle Freiburg
F 200/7 524 Sammelkarte Wiedergutmachung Alte Synagoge Freiburg
F 202/32 6984 Schreiben vom 7.12.1940 (u.a.)
G 816/1 367-396 Kollegiengebäude II, Platz der alten Synagoge 1 / 1954-1970 (22 Einheiten)
N25/2 4 Finanzamt Freiburg-Süd: Verwaltung von jüdischem Vermögen – Kontoblätter jüdischer Kontoinhaber bis 1945
Zentralarchiv zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland:
B1/19, 164 Bezirksstelle der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland: Korrespondenz mit NS-Behörden 1940-1942
B1/19, 338 Aufstellung der Israelitischen Gemeinde Mannheim, 1938
B1/22, 69 Versch. Dossiers, u.a. Korrespondenz mit der Landesregierung 1945-1953
B1/22, 101 Kauf und Verwaltung von Gemeindeimmobilien 1947-1954
B1/22, 102 Protokolle und Aktennotizen: Oberrat, Vorstand, Gemeindeversammlungen 1946-1968
B1/22, 134 Korrespondenz der Gemeinde mit dem Amt für Wiedergutmachung, 1948
B1/22, 191 Allgemeine Korrespondenz (auch über Mitglieder) M-R 1947-1950
B1/22, 192 Allgemeine Korrespondenz, G-M 1945-1948
B1/22, 194 Allgemeine Korrespondenz P-Z 1945-1949
B1/22, 198 Allgemeine Korrespondenz A-F 1946-1948
B1/22, 204 Korrespondenz mit der Polizeidirektion, Abteilung jüdisches Vermögen 1940-1942
Generallandesarchiv Karlsruhe:
GLA, Abt. 237/Zugang 1967-19, 2106
Mikrofilmbestand der Israelitischen Gemeinde Freiburg KdöR:
Rolle 2: Schriftwechsel G-M, 1945-1948, Korrespondenz mit amerikanischen, französischen, israelischen und deutschen Organisationen im Zusammenhang mit den DP`s und Flüchtlingen, Todeserklärungen, Verfolgungsbeschreibungen, Anfragen; Posteingangsbuch 1948; Finanzen der Gemeinde 1927-1938
Liegenschaftsamt Freiburg:
Registratur, Platz der Alten Synagoge Schriftverkehr, Verträge 1939-2018
Vermessungsamt Freiburg
Lagerbuch der Gemarkung Freiburg
Historisches Institut der Deutschen Bank:
HADB F33-526 Kontoübersichten Israelitische Gemeinde Freiburg
Veröffentlichte Quellen:
Elke Fröhlich (Hg.): Die Tagebücher von Joseph Goebbels. Sämtliche Fragmente, Teil I, Bd. 6, August 1938 bis Juni 1939, München 1998.
Martin Friedenberger: Die Rolle der Finanzverwaltung bei der Vertreibung, Verfolgung und Vernichtung der deutschen Juden, in: Martin Friedenberger, Klaus-Dieter Gössel, Eberhard Schönknecht (Hg.): Die Reichsfinanzverwaltung im Nationalsozialismus, Bremen 2002, S. 10-94.
Digitalisierte Quellen:
Amtliches Einwohnerbuch der Stadt Freiburg 1949, Universitätsbibliothek Freiburg, Freiburger historische Bestände – digital, abzurufen unter: http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/adr1940/0106 (letzter Aufruf: 29.5.2019).
Badische Gesetz- und Verordnungsblätter – digitalisiert. Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe, 4. Jahrgang, Nummer 6, Ausgabe vom 19. Februar 1949. Abzurufen unter: https://digital.blb-karlsruhe.de/urn/urn:nbn:de:bsz:31-33161 (letzter Aufruf: 14.07.2019)
Deutsches Reichsgesetzblatt, Jahrgänge 1868-1945, abzurufen über Österreichische Nationalbibliothek, ALEX Historische Rechts- und Gesetzestexte online: http://alex.onb.ac.at/tab_dra.htm (letzter Aufruf: 29.05.2019).
Freiburger Zeitung / Freiburger Historische Bestände digital / Universitätsbibliothek Freiburg: Artikel über die Einweihung der Synagoge in der Freiburger Zeitung vom 25.09.1870, einzusehen unter: Universitätsbibliothek Freiburg, Freiburger historische Bestände digital: https://fz.ub.uni-freiburg.de/show/fz.cgi?cmd=showpic&ausgabe=03&day=25&year=1870&month=09&project=3&anzahl=4 (letzter Aufruf: 26.09.2018).
Reichsbürgergesetz und Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre ["Nürnberger Gesetze"], 15. September 1935, und die beiden ersten Ausführungsbestimmungen, 14. November 1935, abzurufen über: https://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=0007_nue&object=facsimile&st=&l=de (letzter Aufruf: 29.05.2019).
b. Sekundärliteratur
Assmann, Aleida: Geschichte im Gedächtnis. Von der individuellen Erfahrung bis zur öffentlichen Inszenierung, München 2007.
Bajohr, Frank: „Arisierung“ in Hamburg. Die Verdrängung der jüdischen Unternehmer 1933-1945, Hamburg 1997.
Bajohr, Frank: „Arisierung“ in Hamburg: Die Verdrängung der jüdischen Unternehmer, 1933-1945, 2. Auflage, Hamburg 1998.
Barkai, Avraham: Vom Boykott zur „Entjudung“. Der wirtschaftliche Existenzkampf der Juden im Dritten Reich, 1933-1943, Frankfurt a. M. 1988.
Bauerkämper, Arnd: Das umstrittene Gedächtnis. Die Erinnerung an Nationalsozialismus, Faschismus und Krieg in Europa seit 1945, Paderborn 2012.
Baumann, Angelika; Heusler, Andreas (Hg.): München arisiert. Entrechtung und Enteignung der Juden in der NS-Zeit, München 2004.
Blod, Gabriele: Die Entstehung der israelitischen Gemeinde Freiburg 1849-1871, Freiburg i. Br. 1988.
Blod, Gabriele; Fäßler, Peter; Haumann, Heiko; Hundsnurscher, Franz; Schulin, Ernst: Kirchen und Religionsgemeinschaften in Freiburg, in: Haumann, Heiko; Schadek, Hans (Hg.): Geschichte der Stadt Freiburg im Breisgau, Band 3, Von der badischen Herrschaft bis zur Gegenwart, 2. Auflage, Freiburg 2011, S. 485-514.
Bopf, Britta: „Arisierung“ in Köln – die wirtschaftliche Existenzvernichtung der Juden 1933-1945, Köln 2004.
Brucher-Lembach, Andrea: ...wie Hunde auf ein Stück Brot. Die Arisierung und der Versuch der Wiedergutmachung in Freiburg, Bremgarten 2004.
Bruns-Wüstefeld, Alex: Lohnende Geschäfte. Die „Entjudung“ der Wirtschaft am Beispiel Göttingens, Hannover 1997.
Clausing, Kathrin: Leben auf Abruf. Zur Geschichte der Freiburger Juden im Nationalsozialismus, Freiburg i. Br. 2005.
Flümann, Claudia: „...doch nicht bei uns in Krefeld.“ Arisierung, Enteignung, Wiedergutmachung in der Samt- und Seidenstadt 1933-1963, Essen 2015.
Friedenberger, Martin: Die Rolle der Finanzverwaltung bei der Vertreibung, Verfolgung und Vernichtung der deutschen Juden, in: Martin Friedenberger, Klaus-Dieter Gössel, Eberhard Schönknecht (Hg.): Die Reichsfinanzverwaltung im Nationalsozialismus. Darstellung und Dokumente, Bremen 2002, S. 10-94.
FREIeBÜRGER. Unabhängige Straßenzeitung für Freiburg und das Umland zur Unterstützung von Menschen in sozialen Notlagen, Oktober 2017.
Friedländer, Saul: Das Dritte Reich und die Juden, München 2007.
Frenzel, Martin (Hg.): „Eine Zierde unserer Stadt“. Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Liberalen Synagoge Darmstadt, Darmstadt 2008.
Fritsche, Christiane: Ausgeplündert, zurückerstattet und entschädigt: Arisierung und Wiedergutmachung in Mannheim, 2. Aufl., Ubstadt-Weiher 2013.
Gibas, Monika: „Arisierung“ in Thüringen. Ausgegrenzt, ausgeplündert, ausgelöscht, Leipzig 2009.
Goodnews4.de: Extra-Ausgabe der Online-Tageszeitung goodnews4.de: 80 Jahre Vernichtung der Synagoge November 1938. Baden-Baden Synagogen-Diskussion 2018, 10. November 2018.
Goschler Constantin: Wiedergutmachung. Westdeutschland und die Verfolgten des Nationalsozialismus 1945-1954 (Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte Band 34), München 1992.
Goschler, Constantin; Ther, Philipp (Hg.): Raub und Restitution. „Arisierung“ und Rückerstattung des jüdischen Eigentums in Europa, Frankfurt/Main 2003.
Goschler, Constantin: Schuld und Schulden. Die Politik der Wiedergutmachung für NS-Verfolgte seit 1945 (Beiträge zur Geschichte des 20. Jahrhunderts, Band 111), Göttingen 2005.
Goschler, Constantin: Wiedergutmachung. Ein Grundbegriff des deutschen Politikdiskurses von der Nachkriegszeit bis heute, in: Alfons Kenkmann / Christoph Spieker / Bernd Walter (Hg.): Wiedergutmachung als Auftrag. Begleitband zur gleichnamigen Ausstellung – Geschichtsort Villa ten Hompel, Essen 2007, S. 81-82.
Goschler, Constantin: Zwei Wellen der Restitution. Die Rückgabe des jüdischen Eigentums nach 1945 und 1990, in: Haus der Geschichte Baden-Württembergs (Hg.): „Unrecht gut gedeiht nicht“. „Arisierung“ und Versuche der Wiedergutmachung, Heidelberg 2015 (Laupheimer Gespräche), S. 101-119.
Graus, Frantisek: Pest – Geissler – Judenmorde. Das 14. Jahrhundert als Krisenzeit, Göttingen 1987.
Hahn, Joachim; Krüger, Jürgen (Hg.): Synagogen in Baden-Württemberg. Geschichte und Architektur, Stuttgart 2007.
Hammer-Schenk, Harold: Synagogen in Deutschland. Geschichte einer Baugattung im 19. und 20. Jahrhundert (1780 – 1933), Hamburg 1981, Teil 1-2.
Haumann, Heiko: Juden in Freiburg i. Br. von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart: Assimilation, Antisemitismus, Suche nach Identität, in: Vorarlberger Landesarchiv (Hg.): Landjudentum im Süddeutschen und Bodenseeraum. Wissenschaftliche Tagung zur Eröffnung des jüdischen Museums Hohenheim, Dornbirn 1992, S. 155-162.
Haumann, Heiko; Rübsam, Dagmar; Schnabel, Thomas; Ueberschär, Gerd R.: Hakenkreuz über dem Rathaus. Von der Auflösung der Weimarer Republik bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs (1930-1945), in: Haumann, Heiko; Schadek, Hans (Hg.): Geschichte der Stadt Freiburg im Breisgau, Band 3, Von der badischen Herrschaft bis zur Gegenwart, 2. Auflage, Freiburg 2011, S. 297-371.
Herbst, Ludolf; Goschler, Constantin (Hrsg.); Wiedergutmachung in der Bundesrepublik Deutschland (Schriftenreihe der Vierteljahreszeitschrift für Zeitgeschichte: Sondernummer), München 1989.
Hockerts, Hans Günter: Wiedergutmachung in Deutschland. Eine historische Bilanz 1945-2000, Vierteljahreszeitschrift für Zeitgeschichte 49, 2001, S. 167-214.
Hockerts, Hans Günter; Kuller, Christiane: Nach der Verfolgung – Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts in Deutschland? Göttingen 2003.
Hockerts, Hans Günter; Kuller, Christine; Drecoll, Axel; Winster, Tobias: Die Finanzverwaltung und die Verfolgung der Juden in Bayern – Bericht über ein Forschungsprojekt der LMU München in Kooperation mit der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, München 2004.
Hundsnurscher, Franz; Taddey, Gerhard: Die jüdischen Gemeinden in Baden. Denkmale, Geschichte, Schicksale, Stuttgart 1968.
James, Harold: Die Deutsche Bank und die „Arisierung“, München 2001.
Klatt, Marlene: Die Wiedergutmachungsrealität aus Sicht der jüdischen Verfolgten. Ein Beitrag zum Klima der Wiedergutmachung in der frühen Bundesrepublik, in: Geschichtsort Villa ten Hompel; Kenkmann, Alfons (Hg.): Wiedergutmachung als Auftrag. Begleitband zur gleichnamigen Ausstellung, Essen 2007, S. 137-156.
Klatt, Marlene: Unbequeme Vergangenheit – Antisemitismus, Judenverfolgung und Wiedergutmachung in Westfalen 1925-1965, Paderborn 2009.
Kreutzmüller, Christoph: Ausverkauf – Die Vernichtung der jüdischen Gewerbetätigkeit in Berlin 1930-1945, Berlin 2012.
Kuller, Christiane: Der arrangierte Normenstaat. Die staatliche Finanzverwaltung und die wirtschaftliche Ausplünderung der deportierten Juden, in: Sven Reichardt, Wolfgang Seibel (Hg.): Der prekäre Staat: Herrschen und Verwalten im Nationalsozialismus, Frankfurt a.M. 2011, S. 213-240.
Langrock, Matthias: Eine Frage der Existenz. Die Synagogengemeinde und die Entschädigung für Kölner Juden, in: Norbert Frei, José Brunner, Constantin Goschler (Hg.): Die Praxis der Wiedergutmachung. Geschichte, Erfahrung und Wirkung in Deutschland und Israel, Göttingen 2009, S.126-158.
Lillteicher, Jürgen: Westdeutschland und die Restitution jüdischen Eigentums in Europa, in: Goschler, Constantin; Ther, Philipp (Hg.): Raub und Restitution. „Arisierung“ und Rückerstattung des jüdischen Eigentums in Europa, Frankfurt/Main 2003, S. 92-107.
Meyer, Beate: Tödliche Gratwanderung. Die Reichsvereinigung der Juden in Deutschland zwischen Hoffnung, Zwang, Selbstbehauptung und Verstrickung (1939-1945), Göttingen 2011.
Middendorff, Wolf: Als die Synagogen brannten, in: Freiburger Almanach 1979, S. 67-73
Middendorff, Wolf: Die „Reichskristallnacht“ in historischer und kriminologischer Sicht, in: Schau-ins-Land 107 (1988), S. 227-245.
Obst, Dieter: „Reichskristallnacht” – Ursachen und Verlauf des antisemitischen Pogroms vom November 1938, Frankfurt a. M. 1991.
Pätzold, Kurt: Artikel „Reichskristallnacht“, in: Benz, Wolfgang; Graml, Hermann; Weiß, Hermann (Hg.): Enzyklopädie des Nationalsozialismus, 3. korrigierte Auflage, Stuttgart 1998, S. 679.
Pollmeier, Heiko: Artikel „Arisierung“, in: Benz, Wolfgang; Graml, Hermann; Weiß, Hermann (Hg.): Enzyklopädie des Nationalsozialismus, 3. korrigierte Auflage, Stuttgart 1998, S. 374-375.
Pross, Christian: Wiedergutmachung. Der Kleinkrieg gegen die Opfer, Frankfurt/Main 1988.
Rummel, Walter; Rath, Wolfgang: „Dem Reich verfallen“ – „den Berechtigten zurückzuerstatten“, Enteignung und Rückerstattung jüdischen Vermögens im Gebiet des heutigen Rheinland-Pfalz 1938-1953, Koblenz 2001.
Scherb, Ute: Wir bekommen die Denkmäler, die wir verdienen. Freiburger Monumente im 19. und 20. Jahrhundert, Freiburg i. Brsg. 2005.
Schwendemann, Heinrich: Baupolitik im Freiburg der NS-Zeit, in: Badische Heimat. Zeitschrift für Landes- und Volkskunde, Natur-, Umwelt- und Denkmalschutz, Heft 1, März 2018, S. 23-39.
Simon, Hermann: Die Neue Synagoge Berlin, „zum Ruhme Gottes und zur Zierde der Stadt“, Berlin 2011.
Stadtarchiv Freiburg (Hg.): Das Schicksal der Freiburger Juden am Beispiel des Kaufmanns Max Mayer und die Ereignisse des 9./10. November 1938, mit Beiträgen von Rolf Böhme und Heiko Haumann, Freiburg i. Br. 1989.
Stiekel, Sebastian: Arisierung und Wiedergutmachung in Celle, Bielefeld 2008.
Teschner, Gerhard J.: Die Deportation der badischen und saarpfälzischen Juden vom 22. Oktober 1940. Vorgeschichte und Durchführung der Deportation bis zum Kriegsende im Kontext der deutschen und französischen Judenpolitik, Frankfurt/Main 2002.
Twiehaus, Christiane: Synagogen im Großherzogtum Baden (1806-1918). Eine Untersuchung zu ihrer Rezeption in den öffentlichen Medien, Heidelberg 2012.
Unfried, Bertold: Vergangenes Unrecht. Entschädigung und Restitution in einer globalen Perspektive, Göttingen 2014.
Vordtriede, Käthe: „Es gibt Zeiten, in denen man welkt“. Mein Leben in Deutschland vor und nach 1933, herausgegeben von Detlef Garz, Lengwil 1999.
Wegmann, Heiko: Die Reichspogromnacht in Freiburg – Eskalation des Antisemitismus, in: Kalchthaler, Peter; Neisen, Robert; von Stockhausen, Tilmann (Hg.): Nationalsozialismus in Freiburg, Begleitbuch zur Ausstellung des Augustinermuseum , Petersberg 2016, S. 222 .
Weismann, Ernest H.: Die Nachfolge-Organisationen, in: Bundesministerium der Finanzen (Hrsg.): Die Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts durch die Bundesrepublik Deutschland, Bd. II, Das Rückerstattungsgesetz, München 1981.
Wolter, Markus: Ein wertvoller historischer Fund, Artikel in der Badischen Zeitung vom 9.11.2018, S. 22.
Wolter, Markus: Am Synagogenstein. Ein Foto, ein Jurastudent und die Pogromnacht gegen die Juden – Wolf Middendorff und der 10. November 1938 in Freiburg, in: Badische Zeitung, Magazin, vom 26.2.2018, S. III.
Internetauftritte
Alemannia Judaica, Arbeitsgemeinschaft für die Erforschung der Geschichte der Juden im süddeutschen und angrenzenden Raum, abzurufen unter: http://www.alemannia-judaica.de/freiburg_synagoge_n.htm (letzter Aufruf: 14.04.2019).
Deutschlandfunk vom 29.12.2016: „Freiburger Synagogen Streit. Neuer Zoff um alte Mauerreste“ von Thomas Wagner, abzurufen unter: https://www.deutschlandfunk.de/freiburger-synagogen-streit-neuer-zoff-um-alte-mauerreste.886.de.html?dram:article_id=374878 (letzter Aufruf: 29.05.2019).
Deutschlandfunk vom 14.12.2012: „Segen oder Sekte? Der wachsende Einfluss der jüdisch-orthodoxen Chabat Lubawitsch Bewegung“, von Ayala Goldmann, abzurufen über: https://www.deutschlandfunkkultur.de/segen-oder-sekte.1079.de.html?dram:article_id=231108, (letzter Aufruf: 14.07.2019).
Egalitäre Jüdische Chawurah Gescher e.V., Internetauftritt, abzurufen unter; http://prd.gescher-freiburg.de/ (letzter Aufruf: 29.05.2019).
Ehemaligen Synagoge Fellheim, Internetauftriit, abzurufen unter: http://ehemaligesynagogefellheim.de/geschichte-des-hauses-und-umgebung/ (letzter Aufruf: 13.04.2019).
Frei, Norbert: „Machtergreifung“. Zu einem historischen Begriff, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, Jahrgang 31, Heft 1 (1983), S. 138-145, abzurufen unter: https://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1983_1.pdf (letzter Aufruf: 3.3.2019).
Freiburger Stadtbau GmbH (Hg.): 90 Jahre Freiburger Stadtbau. Eine Dokumentation, Freiburg 2009, abzurufen über: https://www.freiburger-stadtbau.de/fileadmin/pdf/FSB-Doku_90.pdf (letzter Aufruf: 26.05.2019).
Gemeinderatsdrucksache G-18/100: Ergebnisse und Empfehlungen zum Umgang mit den Fundamentresten auf dem Platz der Alten Synagoge, abzurufen unter: https://ris.freiburg.de/show_anlagen.php?_typ_432=vorl&_doc_n1=20180604152249.pdf&_vorl_nr=3770503100101&_nid_nr=&_nk_nr=377 (letzter Aufruf: 30.07.2019).
Gemeinderatsdrucksache G-19/081: Platz der Alten Synagoge: Ergänzende Maßnahmen zum Erinnerungsbrunnen, abzurufen unter: https://ris.freiburg.de/show_anlagen.php?_typ_432=vorl&_sid=ni_2019-GR-187&_topst=1&_vorl_nr=4061802100081&_doc_n1=20190327120900.pdf (letzter Aufruf: 30.07.2019).
Habres, Michael: Die Wiederherstellung der ehemaligen Synagoge in Fellheim, in: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege (Hg.): Denkmalpflege Informationen, Nr. 163, März 2016, S. 24, abzurufen unter: http://www.blfd.bayern.de/medien/denkmalpflege_informationen_163.pdf (letzter Aufruf: 13.04.2019).
Höhl, Simone: „Jetzt entsteht Freiburgs neue Mitte: Platz der Alten Synagoge wird zur Baustelle“ Artikel in der Badischen Zeitung vom 19.04.2016, abzurufen unter: https://www.badische-zeitung.de/jetzt-entsteht-freiburgs-neue-mitte-platz-der-alten-synagoge-wird-zur-baustelle--120909094.html (letzter Aufruf: 29.05.2019).
Höhl, Simone: „Stadt bessert bei Brunnen nach“ Artikel in der Badischen Zeitung vom 9.5.2019, abzurufen unter: https://www.badische-zeitung.de/freiburg/stadt-bessert-bei-brunnen-nach--172871622.html (letzter Aufruf: 29.05.2019).
Israelitischen Gemeinde Freiburg KdöR, Internetauftritt, Kapitel „Geschichte der Gemeinde“, abzurufen unter: http://www.jg-fr.de/geschichte.html (letzter Aufruf: 14.04.2019).
Kalchthaler, Peter; Röderer Joachim: „Durchfahrt verboten“, Artikel in der Online-Ausgabe der Badischen Zeitung vom 25. August 2012, abzurufen unter: https://www.badische-zeitung.de/freiburg/durchfahrt-verboten--63308709.html (letzter Aufruf: 14.04.2019).
Korn, Salomon: Vorwort zum Synagogendossier auf der Webseite des Zentralrats der Juden, online archiviert und abzurufen unter: https://archive.fo/20160220193544/http://www.zentralratdjuden.de/de/topic/385.html (letzter Aufruf: 30.07.2019).
Kuhn, Philip: WELT Online: „Bierflaschen kühlen, wo die Synagoge brannte“ vom 10.08.2017, abzurufen über: https://www.welt.de/politik/deutschland/article167568694/Bierflaschen-kuehlen-wo-die-Synagoge-brannte.html (letzter Aufruf: 20.05.2019).
Kuller, Christiane: Finanzverwaltung und Judenverfolgung, Antisemitische Fiskalpolitik und Verwaltungspraxis im nationalsozialistischen Deutschland, zeitenblicke 3 (2004), Nr. 2, abzurufen unter: http://www.zeitenblicke.de/2004/02/kuller/index.html, (letzter Aufruf: 22.09.2018).
Kuller, Christiane: „Geschichte der Landesministerien in Baden und Württemberg in der Zeit des Nationalsozialismus“, Projektskizze und Exposé sind einsehbar unter: https://ns-ministerien-bw.de/wp-content/uploads/2014/09/Expose_Forschungsprojekt_NS-Vergangenheit_der_Landesministerien.pdf (letzter Aufruf: 22.09.2018).
Leserbrief in der Badischen Zeitung vom 14. November 2016, „Uns Buben dienten die Trümmer als Spielterrain“, abzurufen unter: https://www.badische-zeitung.de/leserbriefe-freiburg/uns-buben-dienten-die-truemmer-als-spielterrain--129789229.html (letzter Aufruf: 07.04.2019).
Littmann, Julia: „Wir umarmen alle Juden“, Artikel in der Badischen Zeitung Online vom 3. Dezember 2015, abzurufen unter: https://www.badische-zeitung.de/freiburg/wir-umarmen-alle-juden--114626695.html (letzter Aufruf: 14.07.2019).
von Lüpke-Schwarz, Marc: Juden im Ersten Weltkrieg, Deutsche Welle 2014, abzurufen unter: https://www.dw.com/de/juden-im-ersten-weltkrieg/a-17808361, (letzter Aufruf: 29.05.2019).
Stadt Freiburg: „Platz der Alten Synagoge. Erinnern und Gedenken an den Vernichtungswahn“, abzurufen unter: https://www.freiburg.de/pb/1029943.html (letzter Aufruf: 29.05.2019).
Stadtarchiv Freiburg i . Brsg.: K1/44 Schriftlicher Nachlass von Prof. Dr. h.c. Joseph Schlippe (1885 – 1970), Vorwort und Arbeitsbericht, S.1-2, abzurufen unter: https://www.freiburg.de/pb/site/Freiburg/get/369386/Stadtarchiv_K1_44_Schlippe.pdf (letzter Aufruf: 07.04.2019).
Thamer, Hans-Ulrich: Wirtschaft und Gesellschaft unterm Hakenkreuz, abzurufen unter: https://www.bpb.de/geschichte/nationalsozialismus/dossier-nationalsozialismus/39551/wirtschaft-und-gesellschaft?p=all (letzter Aufruf: 06.03.2019).
Universität Freiburg: Interview mit Dr. Heinrich Schwendemann vom 03.08.2017, abzurufen unter: http://www.pr.uni-freiburg.de/pm/online-magazin/erleben-und-mitmachen/die-wuerde-des-ortes-wahren; (letzter Aufruf: 29.05.2019).
„Verwertung“ Begriffsdefinition bei der Bundeszentrale für politische Bildung, abzurufen unter: http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/lexikon-der-wirtschaft/21052/verwertung (letzter Aufruf: 26.5.2019).
Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, Jahrgang 31, Heft 1 (1983), S. 138-145, abzurufen über: https://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1983_1.pdf (letzter Aufruf: 29.05.2019).
Vögtle, Fabian in der Online-Ausgabe der Badischen Zeitung vom 19.02.2018: Das Gurs-Schild soll zurück auf den Platz der Alten Synagoge – jedoch an einen anderen Ort, abzurufen unter: https://www.badische-zeitung.de/das-gurs-schild-soll-zurueck-auf-den-platz-der-alten-synagoge-jedoch-an-einen-anderen-ort (letzter Aufruf: 14.04.2019).
Vögtle, Fabian in der Online-Ausgabe der Badischen Zeitung vom 25.07.2019: Stadt Freiburg und zwei jüdische Gemeinden einigen sich über die Gestaltung des Synagogenbrunnens, abzurufen unter:
https://www.badische-zeitung.de/kompromiss-zur-brunnengestaltung--175699155.html (letzter Aufruf: 25.08.2019).
Wegmann, Heiko: Die Brandnacht vor 75 Jahren. Die SS und das Reichspogrom vom 9. November 1938 in Freiburg, Artikel in der Badischen Zeitung Online vom 9.11.2013, abzurufen unter: https://www.badische-zeitung.de/freiburg/die-brandnacht-vor-75-jahren--76997395.html (letzter Aufruf: 20.08.2019).
Zimmermann, Eva: „Flur, Flurstück, Grundstück: Was ist der Unterschied?“ abzurufen unter: https://www.houzz.de/magazin/flur-flurstueck-grundstueck-was-ist-der-unterschied-stsetivw-vs~76531094 (letzter Aufruf: 31.07.2019).
Zimmermann, Frank: Unter welchen Umständen wurde 1939 das Synagogengrundstück an die Stadt verkauft? Artikel in der Badischen Zeitung vom 2. Juni 2018, abzurufen unter: https://www.badische-zeitung.de/freiburg/unter-welchen-umstaenden-wurde-1939-das-synagogengrundstueck-an-die-stadt-verkauft--153180894.html (letzter Aufruf: 21.09.2018).
[1] Zitiert in: Arnd Bauerkämper: Das umstrittene Gedächtnis. Die Erinnerung an Nationalsozialismus, Faschismus und Krieg in Europa seit 1945, Paderborn 2012, S. 11.
[2] Die 1869/70 erbaute Synagoge wird im Folgenden als „Alte Synagoge“ bezeichnet. Dieser Ausdruck hat sich nicht zuletzt seit dem Bau einer neuen Synagoge in Freiburg im Jahr 1985 im allgemeinen Sprachgebrauch etabliert. Die neue Synagoge befindet sich heute unweit des Freiburger Münsters, Ecke Nußmann-/Engelstraße.
[3] Damit ist physische aber auch psychische Gewalt gegen die jüdische Bevölkerung Freiburgs gemeint. Dazu zählt zum Beispiel der am 1. April 1933 stattgefundene Boykott gegen jüdische Geschäfte und Einrichtungen in Freiburg. Vgl. Andrea Brucher-Lembach: ...wie Hunde auf ein Stück Brot. Die Arisierung und der Versuch der Wiedergutmachung in Freiburg, Bremgarten 2004, S. 27-34.
Anmerkung zur Schreibweise „Jüdinnen und Juden“: In der vorliegenden Arbeit wird auf eine durchgehende gendergerechte Schreibweise alleinig aufgrund einer besseren Lesbarkeit verzichtet. Die männliche und/oder weibliche Form schließt dabei stets sämtliche Geschlechterbezeichnungen mit ein.
[4] Vgl. Kathrin Clausing: Leben auf Abruf. Zur Geschichte der Freiburger Juden im Nationalsozialismus, Freiburg i.Br. 2005, S. 93-94.
[5] Zum umstrittenen Begriff der „Wiedergutmachung“, vgl. Kapitel 5.2 dieser Dokumentation; vgl. dazu auch Constantin Goschler: Schuld und Schulden. Die Politik der Wiedergutmachung für NS-Verfolgte seit 1945, Göttingen 2005, S. 11-17.
[6] Die Benutzung des Ausdrucks „Arisierung“ ist in der Forschung sehr umstritten, verweist er doch auf die Entstehung während der Zeit des Nationalsozialismus und des durchaus gängigen Gebrauchs in antisemitischen Kreisen. Nach 1945 wurde der Begriff jedoch auch von Betroffenen selbst verwendet und vor allem in der historiographischen Forschung immer wieder aufgegriffen. Bis dato konnte sich keine alternative Begrifflichkeit durchsetzen. Vgl. dazu auch: Claudia Flümann: „...doch nicht bei uns in Krefeld“ Arisierung, Enteignung, Wiedergutmachung in der Samt- und Seidenstadt 1933-1963, Essen 2015, S. 13. In der vorliegenden Arbeit soll der Begriff in Anführungszeichen als terminus technicus verwendet werden.
[7] Vgl. Brucher-Lembach: ...wie Hunde auf ein Stück Brot.
[8] Die Israelitische Gemeinde Freiburg KdöR (im Folgenden in der Kurzform als „Israelitische Gemeinde“ „Israelitische Religionsgemeinschaft“ oder „jüdische Gemeinde“ bezeichnet) ist Rechtsnachfolgerin der bis 1942 bestehenden Israelitischen Kultusgemeinde Freiburg sowie der im Dezember 1945 zunächst als „Israelitische Landesgemeinde für Südbaden“ neu gegründeten jüdischen Gemeinde in Freiburg. Vgl. dazu die Vorgänge in Kap. 5.3 (S. 73ff.) dieser Dokumentation. Neben der Israelitischen Gemeinde Freiburg KdöR vertritt die Egalitäre Jüdische Chawurah Gescher Gemeinschaft, die seit 1998 in Freiburg aktiv ist und im Jahr 2004 einen Trägerverein gegründet hat, das liberale Judentum in Freiburg. Sie greift damit auf liberal-jüdische Traditionen zurück, die bereits vor 1933 als dominierende Ausrichtung in der Einheitsgemeinde bestanden. In der 1864 gegründeten Einheitsgemeinde waren sowohl orthodoxe als auch liberale Mitglieder unter einem Dach vereinigt. Dies führte immer wieder zu internen Spannungen. Vgl. dazu Clausing, S. 42-43; zur Ausrichtung und Präsenz der Egalitären Jüdischen Chawurah Gescher e.V. vgl. Internetauftritt des Egalitären Jüdischen Chawurah Gescher e.V., abzurufen unter; http://prd.gescher-freiburg.de/ (letzter Aufruf: 25.05.2019). Neben diesen beiden Gemeinden ist auch die orthodoxe Chabat Lubawitsch Bewegung in Freiburg aktiv. Im Gegensatz zu den anderen jüdischen Gemeinden praktiziert Chabat Lubawitsch Missionierung und wird u.a. deshalb als Sekte, die dem Judentum nahe steht, bezeichnet. Vgl. Ayala Goldmann: Segen oder Sekte? Der wachsende Einfluss der jüdisch-orthodoxen Chabat Lubawitsch Bewegung, vom 14.12.2012, Deutschlandfunk, abzurufen über: https://www.deutschlandfunkkultur.de/segen-oder-sekte.1079.de.html?dram:article_id=231108, (letzter Aufruf: 14.07.2019). In Freiburg ist Chabat Lubawitsch seit 2015 tätig. Vgl. dazu: Julia Littmann: „Wir umarmen alle Juden“, Artikel in der Badischen Zeitung Online vom 3. Dezember 2015, abzurufen unter: https://www.badische-zeitung.de/freiburg/wir-umarmen-alle-juden--114626695.html (letzter Aufruf: 14.07.2019).
[9] Zum Beispiel: Martin Frenzel (Hg.): „Eine Zierde unserer Stadt“. Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Liberalen Synagoge Darmstadt, Darmstadt 2008; Hermann Simon: Die Neue Synagoge Berlin, „zum Ruhme Gottes und zur Zierde der Stadt“, Berlin 2011.
[10] Vgl. Gabriele Blod: Die Entstehung der israelitischen Gemeinde Freiburg 1849-1871, Freiburg i. Br. 1988, S. 56-61.
[11] Vgl. Brucher-Lembach, S. 75.
[12] Vgl. Clausing, S. 93-94.
[13] Kaufvertrag zwischen der Stadt Freiburg und dem „Oberrat der Israeliten“ vom 15. März 1939, Stadtarchiv Freiburg (StadtAF), C4/VII/12/5.
[14] Vgl. Zustimmung des OB mit Verfügung vom 29.4.1939, Genehmigung des Finanz- und Wirtschaftsministers vom 22.5.1939, Bestätigung des Synagogenrats vom 23.8.1939 über den Eingang auf ein Sperrkonto, StadtAF, C4/VII/12/5; die Genehmigung durch den Finanz- und Wirtschaftsminister findet sich auch in der Registratur des Freiburger Liegenschaftsamtes (RLF). Hier konnte die Autorin mit Genehmigung des Auftraggebers relevante Dokumente einsehen, die die eigentumsrechtlichen Verhältnisse am Werthmannplatz/Platz der Alten Synagoge von 1939 bis 1978 widerspiegeln. Die Einsicht erfolgte vor Ort am 13.02.2019.
[15] Vgl. Artikel in der Badischen Zeitung vom 2. Juni 2018, abzurufen unter: https://www.badische-zeitung.de/freiburg/unter-welchen-umstaenden-wurde-1939-das-synagogengrundstueck-an-die-stadt-verkauft--153180894.html (letzter Aufruf: 21.09.2018).
[16] Ausnahmen bilden: Hermann Simon: Die Neue Synagoge Berlin; Frenzel: Liberale Synagoge Darmstadt, sowie die Überblicksdarstellungen von Joachim Hahn und Jürgen Krüger (Hg.): Synagogen in Baden-Württemberg. Geschichte und Architektur, Stuttgart 2007, oder Christiane Twiehaus: Synagogen im Großherzogtum Baden (1806-1918). Eine Untersuchung zu ihrer Rezeption in den öffentlichen Medien, Heidelberg 2012; Ein frühes Grundlagenwerk schuf Harold Hammer-Schenk: Synagogen in Deutschland. Geschichte einer Baugattung im 19. Und 20. Jahrhundert (1780 – 1933), Hamburg 1981, Teil 1-2.
[17] Vgl. FN 10, 3 und 4.
[18] Vgl. FN 6.
[19] Vgl. Flümann, S. 8.
[20] Arbeiten, in welchen sowohl der Aspekt der „Arisierung“ als auch jener der Restitution bzw. der „Wiedergutmachung“ diskutiert wurden, sind zum Beispiel: Christiane Fritsche: Ausgeplündert, zurückerstattet und entschädigt: Arisierung und Wiedergutmachung in Mannheim, 2. Aufl., Ubstadt-Weiher 2013; Marlene Klatt: Unbequeme Vergangenheit – Antisemitismus, Judenverfolgung und Wiedergutmachung in Westfalen 1925-1965, Paderborn 2009; Walter Rummel, Wolfgang Rath: „Dem Reich verfallen“ – „den Berechtigten zurückzuerstatten“, Enteignung und Rückerstattung jüdischen Vermögens im Gebiet des heutigen Rheinland-Pfalz 1938-1953, Koblenz 2001.
[21] Einen guten Überblick bietet Flümann, S. 6-7.
[22] Vgl. Frank Bajohr: „Arisierung“ in Hamburg. Die Verdrängung der jüdischen Unternehmer 1933-1945, Hamburg 1997; Alex Bruns-Wüstefeld: Lohnende Geschäfte. Die „Entjudung“ der Wirtschaft am Beispiel Göttingens, Hannover 1997; Angelika Baumann, Andreas Heusler (Hg.): München arisiert. Entrechtung und Enteignung der Juden in der NS-Zeit, München 2004; Britta Bopf: „Arisierung“ in Köln – die wirtschaftliche Existenzvernichtung der Juden 1933-1945, Köln 2004; Sebastian Stiekel: Arisierung und Wiedergutmachung in Celle, Bielefeld 2008; Monika Gibas: „Arisierung“ in Thüringen. Ausgegrenzt, ausgeplündert, ausgelöscht, Leipzig 2009; Christoph Kreutzmüller: Ausverkauf – Die Vernichtung der jüdischen Gewerbetätigkeit in Berlin 1930-1945, Berlin 2012.
[23] Vgl. Constantin Goschler: Schuld und Schulden. Die Politik der Wiedergutmachung für NS-Verfolgte seit 1945 (Beiträge zur Geschichte des 20. Jahrhunderts, Band 111), Göttingen 2005; Constantin Goschler: Wiedergutmachung. Westdeutschland und die Verfolgten des Nationalsozialismus 1945-1954 (Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte Band 34), München 1992; Constantin Goschler; Philipp Ther (Hg.): Raub und Restitution. „Arisierung“ und Rückerstattung des jüdischen Eigentums in Europa, Frankfurt/Main 2003; Hans Günter Hockerts: Wiedergutmachung in Deutschland. Eine historische Bilanz 1945-2000, Vierteljahreszeitschrift für Zeitgeschichte 49, 2001, S. 167-214; Hans Günter Hockerts, Christiane Kuller: Nach der Verfolgung – Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts in Deutschland? Göttingen 2003.
[24] Schwarz war als Anwalt jüdischer NS-Opfer tätig, Grossmann war Mitarbeiter der Claims Conference. Vgl.
Herbst, Ludolf; Goschler Constantin (Hrsg.); Wiedergutmachung in der Bundesrepublik Deutschland (Schriftenreihe der Vierteljahreszeitschrift für Zeitgeschichte: Sondernummer), München 1989, S.12.
[25] Christian Pross: Wiedergutmachung. Der Kleinkrieg gegen die Opfer, Frankfurt/Main 1988.
[26] Vgl. Goschler: Schuld und Schulden, S. 17-18.
[27] Vgl. Hans Günter Hockerts, Christine Kuller, Axel Drecoll, Tobias Winster: Die Finanzverwaltung und die Verfolgung der Juden in Bayern – Bericht über ein Forschungsprojekt der LMU München in Kooperation mit der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, München 2004; Christiane Kuller: Finanzverwaltung und Judenverfolgung, Antisemitische Fiskalpolitik und Verwaltungspraxis im nationalsozialistischen Deutschland, zeitenblicke 3 (2004), Nr. 2, abzurufen unter: http://www.zeitenblicke.de/2004/02/kuller/index.html, (letzter Aufruf: 22.09.2018); Christiane Kuller: Der arrangierte Normenstaat. Die staatliche Finanzverwaltung und die wirtschaftliche Ausplünderung der deportierten Juden, in: Sven Reichardt, Wolfgang Seibel (Hg.): Der prekäre Staat: Herrschen und Verwalten im Nationalsozialismus, Frankfurt a.M. 2011, S. 213-240; vgl. darüber hinaus das derzeit laufende Forschungsvorhaben, an dem Christiane Kuller beteiligt ist: „Geschichte der Landesministerien in Baden und Württemberg in der Zeit des Nationalsozialismus“, Projektskizze und Exposé sind einsehbar unter: https://ns-ministerien-bw.de/wp-content/uploads/2014/09/Expose_Forschungsprojekt_NS-Vergangenheit_der_Landesministerien.pdf (letzter Aufruf: 22.09.2018).
[28] Vgl. dazu auch: Martin Friedenberger: Die Rolle der Finanzverwaltung bei der Vertreibung, Verfolgung und Vernichtung der deutschen Juden, in: Martin Friedenberger, Klaus-Dieter Gössel, Eberhard Schönknecht: Die Reichsfinanzverwaltung im Nationalsozialismus. Darstellung und Dokumente, Bremen 2002, S. 10-94.
[29] Harold James: Die Deutsche Bank und die „Arisierung“, München 2001.
[30] Vgl. Heinrich Schwendemann: Baupolitik im Freiburg der NS-Zeit, in: Badische Heimat. Zeitschrift für Landes- und Volkskunde, Natur-, Umwelt- und Denkmalschutz, Heft 1, März 2018, S. 23-39.
[31] Vgl. Akte „Ankauf der ehem. Synagoge und des israel. Gemeindehauses Werthmannplatz 3 und 1“: StadtAF, C4/VII/12/5.
[32] Im Stadtarchiv Freiburg (StadtAF) konnten insgesamt gesichtet werden: C2/75/1 Judensachen, Errichtung einer Synagoge; C2/124/1 Geländeerwerb der Stadt beim Synagogenrat zum Bau der Werderstraße; C2/9/4 Bausachen. (Baugesuch Synagogenrat 19.01.1889); C3/20/3 Synagoge an der Werderstraße; C4/I/16/10 Synagoge; C4/I/19/03 (private Bausachen, Baugesuch an der Bertoldstr. 42/44 Werthmannplatz/Löwenbrauerei); C4/II/6/8; C4/II/16/1; C4/VII/12/5 Gemeindevermögen, Ankauf von Grundstücken; C4/VII/33/13 Gemeindevermögen. Werthmannplatz 1; C4/XII/28/6 Anlage eines Parkplatzes auf dem früheren Synagogengelände; C4/XIII/33/10 Beschlagnahme und Verwaltung des Vermögens politischer und religiöser Organisationen sowie des jüdischen Besitzes; C5/2471 Synagoge; C5/4355 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaft u. Verkehr, Friedhöfe / Israelitischer Friedhof 1945-62; D.Li.244 Jüdischer Grundbesitz / Häuser; D.Li. 245-247 Bescheinigung über Abgabe des jüd. Vermögens; D.Li. 248-252 Restitution jüd. Vermögens; D.Ti. (2011) 437 Sammlung von Situationsplänen Werderstraße; GB 47 Nr. 128 Auszug aus dem Grundbuch von 1869.
[33] Vgl. StadtAF, C5/4355, Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaft u. Verkehr, Friedhöfe / Israelitischer Friedhof 1945-62.
[34] Nach Auskunft des Staatsarchivs Freiburg (StAF) sind Unterlagen zu Verwaltung und Restitution jüdischen Vermögens nach 1945 vor allem in den dort verwahrten Unterlagen des Landesamts für Wiedergutmachung, Außenstelle Freiburg (Bestand F 196/1), der Oberfinanzdirektion Freiburg-Land (Bestände F 200 und F 202) der Oberfinanzdirektion Freiburg-Bund (Bestand P 303/4) sowie des Landgerichts Freiburg-Restitutionskammer (Bestand F 166/3) vorhanden. Im Staatsarchiv Freiburg eingesehene Akten sind: F 202/32 6984 Schreiben vom 07.12.1940; N25/2 Nr. 4 Finanzamt Freiburg-Stadt: Verwaltung von jüdischem Vermögen – Kontoblätter jüdischer Kontoinhaber bis 1945; N252/ Nr. 1 Finanzamt Freiburg-Stadt: Verwaltung von jüdischem Vermögen – Forderungen Annahmeordnungen ca. 1942-1943; N25/2 Nr. 3 Finanzamt Freiburg-Stadt: Verwaltung von jüdischem Vermögen 1942; F 166/3 Nr. 965 Israelitische Landesgemeinde Südbaden Freiburg 1948-1949; F 176/1 Nr. 962 Brand der Synagoge in Freiburg 1946-1947; F 176/1 Nr. 960 Brand der Synagogen in Freiburg, Ihringen, Breisach und Eichstetten, antijüdische Ausschreitungen (1947); F176/1 Nr. 964 Brand der Synagoge in Freiburg (1948); F 200/7 Nr. 524 Sammelkarte Wiedergutmachung Alte Synagoge Freiburg (1 Einheit); aus C10/1: 366 Nr. 366 Verwaltung des ehemaligen Reichsvermögens 1948-1952; Nr. 372 Landesamt für kontrolliertes Vermögen 1949-1952; Nr. 59 Oberrat der Israeliten 1946; Nr. 365 Erwerb, Veräußerung und dingliche Belastung von Grundstücken; Grundbesitzverzeichnisse und Grundbuchangelegenheiten sowie Gebäudebeschreibungen 1946-1952; G 816/1 367-396 FR o – 522 Kollegiengebäude II. Platz der alten Synagoge 1 / 1954-1970 (22 Einheiten).
[35] StAF, F 200/7 Nr. 524.
[36] Diese Akte ist bereits durch Andrea Brucher-Lembach erfasst und dokumentiert worden. Vgl. Brucher-Lembach, S. 135-136. Als „Flurstücke“ werden in Deutschland amtlich vermessene Erdoberflächen bezeichnet, die mit einem Grundstück übereinstimmen können, aber nicht müssen. Ein Flurstück bildet die kleinste Vermessungseinheit beim Liegenschaftskatasteramt. Ein Grundstück kann aus mehreren Flurstücken bestehen. Vgl. Artikel „Flur, Flurstück, Grundstück: Was ist der Unterschied?“ von Eva Zimmermann, abzurufen unter: https://www.houzz.de/magazin/flur-flurstueck-grundstueck-was-ist-der-unterschied-stsetivw-vs~76531094
[37] Hier konnte die Autorin mit Genehmigung des Auftraggebers am 13.02.2019 folgende Dokumente (jeweils in Kopie) einsehen: Kaufvertrag vom 15.03.1939 und Genehmigung des Vertrags durch den Badischen Finanz und Wirtschaftsminister vom 22.05.1939; Tauschvertrag zwischen Universität Freiburg und Stadt Freiburg 4H 667/50 aus dem Jahr 1950; Tauschakte vom 23.01.1951; Akte über die Vereinigung der Flurstücke im Oktober 1962; Akte über den Austausch kleinerer Flächen mit dem Land Baden-Württemberg vom 07.01.1963, Übertragung der Flurstücke 474 u.a. von der Universität auf das Land Baden-Württemberg vom 24.04.1964, Vereinigung der Flurstücke 474 u.a. zu Nr. 445 vom 30.01.1967, Kaufvertrag vom 24.10.1978 vom Land Baden-Württemberg zur Errichtung einer öffentl. Tiefgarage; Dokumentation des Dialogverfahrens zur Umgestaltung des Platzes der Alten Synagoge Drucksache G-18/100, Vereinbarung zwischen der Stadt Freiburg und der Universität sowie dem Land Baden-Württemberg über die Gestaltung und Nutzung des Platzes der Alten Synagoge vom 25.10.2012.
[38] Eingesehene Akten aus dem Bestand des Zentralarchivs (ZJD): Aus B1/22 (Freiburg): 101) Kauf- und Verwaltung von Gemeindeimmobilien 1947-1954; 204) (K) Korrespondenz mit der Polizeidirektion, Abteilung jüdisches Vermögen 1940-1942; 134) (K) Korrespondenz der Gemeinde mit dem Amt für Wiedergutmachung 1948, 1942-1948; 69) Deportationslisten (Kopien), 1942 Versch. Dossiers, u.a. Korrespondenz mit der Landesregierung 1945-1953; 195) Allgemeine Korrespondenz A-F 1942-1948; 198) Allgemeine Korrespondenz A-F 1946-1948; 192) Allgemeine Korrespondenz G-M 1945-1948; 194) Allgemeine Korrespondenz P-/ 1945-1949; 196) Allgemeine Korrespondenz H-L 1949-1950; 191) Allgemeine Korrespondenz (auch über Mitglieder) M-R 1947-1950; 197) Allgemeine Korrespondenz S-Z 1949-1951; 207) (K) Erfassung der in Südbaden im Jahre 1933 lebenden Juden, namentliche Aufstellung, Korrespondenz 1946-1950; 102 Protokolle und Aktennotizen: Oberrat, Vorstand, Gemeindesammlungen 1946-1968; 202) (K) Korrespondenz mit anderen jüdischen Gemeinden in Deutschland 1945-1949; 203) (K) Korrespondenz mit dem Comité Central des Juifs Libérés de la Zone Francaise d’ Occupation en Allemagne in Konstanz 1946-1947; 201) (K) Korrespondenz mit dem Jüdischen Weltkongress 1948-1951;
Aus Bestand B1/19: 338) Aufstellung der Israelitischen Gemeinde Mannheim 1938; 164) Bezirksstelle Baden der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland; Korrespondenz mit NS-Behörden 1940-1942; 243) Korrespondenz von Karl Eisemann (Karlsruhe) mit der Reichsvereinigung, Verwaltungsstelle Mannheim 1940-1943; 313) Reichsvereinigung der Juden in Deutschland, Bezirksstelle Baden/Pfalz, Karlsruhe: Judenstern, A-L, 1941-1943; 446) Reichsvereinigung, Verwaltungsstelle Karlsruhe: Empfangsbescheinigungen für Judenstern A-Z, 1941-1943; 312) Reichsvereinigung der Juden in Deutschland, Bezirksstelle Baden/Pfalz, Karlsruhe, außerordentliche Beiträge 1942; 333) Reichsvereinigung Bezirksstelle Baden/Pfalz: Korrespondenz und Mitgliederlisten, 1942-1943.
[39] Eingesehen werden konnten aus dem Bestand des Historischen Instituts der Deutschen Bank: HADB, F33-503, HADB, F33-526, HADB, F33-527 und HADB 0546 (002).
[40] Nach Inkrafttreten der „Verordnung über die Anmeldung des Vermögens von Juden“ am 26. April 1938, waren alle Menschen im Reich, die im Sinne der Nürnberger Gesetze „jüdisch“ waren, dazu angehalten, ihre gesamten in- und ausländischen Vermögenswerte anzumelden und damit offen zu legen. Damit bereiteten die Behörden den Vermögenszugriff auf diese Werte vor. Die Vermögenswerte von emigrierten oder deportierten Juden konnten auf diese Weise relativ leicht „fiskalisch verwertet“ und dem Reichsvermögen zugeführt werden. Vgl. Friedenberger, S. 19.
[41] Die Mitarbeiter des Sonderarchivs in Moskau haben die thematischen Katalogabschnitte zu den Synagogen in Deutschland überprüft und folgendes identifiziert: „Liste der jüdischen Gewerkschaften und Synagogen Deutschlands“, 1932-1933; „Historische Informationen über die Gründung einer Synagoge in Deutschland, über die Adoption und Grundsätze der Charta der jüdischen Kirchengemeinschaft“, 1937; Dokumente des jüdischen Synagogenausschusses, Bromberg-Synagogengemeinschaften, eine Liste deutscher und jüdischer Organisationen in Berlin; Dokumente der Synagogengemeinschaft Greifswald, Mannheim, Stettin. Vgl. Antwortschreiben des Archivs an die Autorin vom 4.3.2019.
[42] Vgl. Anlage 1 im Anhang.
[43] Vgl. Anlage 2 im Anhang.
[44] Zur späten Ansiedelung von Juden in Freiburg, vgl. Hammer-Schenk, S. 194.
[45] Vgl. Clausing, S. 22 , mit Verweis auf Franz Hundsnurscher und Gerhard Taddey: Die jüdischen Gemeinden in Baden. Denkmale, Geschichte, Schicksale, Stuttgart 1968, S. 86-94. Außerdem: in: Graus, Frantisek: Pest – Geissler – Judenmorde. Das 14. Jahrhundert als Krisenzeit, Göttingen 1987, S. 171.
[46] Nach Graus wurden die Juden in Freiburg Anfang des 15. Jahrhunderts endgültig aus der Stadt vertrieben. Vgl. Graus, S. 173.
[47] Vgl. Clausing, S. 22; Hundsnurscher/Taddey sprechen davon, dass auch die zwölf reichsten Juden nicht ermordet wurden, um sich den Schuldnern bedienen zu können und die Ausstände einzutreiben. S. 88.
[48] Vgl. Hundsnurscher/Taddey, S. 10.
[49] Vgl. Hundsnurscher/Taddey, S. 11. Zu den Aufgaben des Oberrats gehörten: Einteilung des Synagogensprengels, die Festsetzung der kirchlichen Abgaben, die Kirchenzucht, die Studienpläne der Religionslehrer und die Beratung der Regierung in jüdischen Angelegenheiten, ebd., S. 11.
[50] Vgl. Twiehaus, S. 3 sowie Clausing, S. 23.
[51] Vgl. Clausing, S. 23. Juden durften sich nicht willkürlich in Städten niederlassen. Dies war ihnen nur in ihren jeweiligen Geburtsorten gestattet. Vgl. Hundsnurscher/Taddey, S. 10.
[52] Vgl. Hundsnurscher/Taddey, S. 90.
[53] Vgl. Hundsnurscher/Taddey S. 90.
[54] Vgl. Twiehaus, S. 3.
[55] Vgl. Twiehaus, S. 10.
[56] Vgl. Blod, S. 14 mit einem Verweis auf Reinhard Rürup, Die Emanzipation der Juden in Baden, in: ders. Emanzipation und Antisemitismus, Göttingen 1975, S. 65.
[57] Vgl. Blod, S. 14.
[58] Vgl. dazu ausführlich: Blod, S. 14-16.
[59] Verhandlungen der badischen Ständekammer, 7. Beilagenheft, S. 103, abgedruckt bei Blod, S. 18.
[60] Vgl. Blod, S. 19.
[61] Ausführlich in Kapitel „Der Fall Näf“, in Blod, S. 20-33.
[62] Diese Entwicklungen waren im Einzelnen: Die Badische Verfassung vom 22. August 1818 bestätigte die Aufnahme als Staatsbürger mit gleichen Rechten, allerdings galt diese Gleichheit nicht in Bezug auf die politischen Rechte und den Zugang zu Staatsämtern, die weiterhin den christlichen Konfessionen vorbehalten blieben, vgl. Clausing, S. 23-24. Auch die Revolution von 1848 brachte für die Emanzipation erneut nur eine Teillösung: Zwar wurden den Juden nun alle staatsbürgerlichen politischen Rechte gewährt, d.h. die Zulassung zum Staatsdienst und die Wählbarkeit für politische Ämter. Städtische Bürger erhielten auch den Zugang zu Ämtern, aber es erfolgte keine generelle Gleichstellung der Juden in Bezug auf die gemeindebürgerlichen Rechte, vgl. Clausing, S. 26.
[63] Vgl. Clausing, S. 27.
[64] Vgl. Blod, S. 37.
[65] Vgl. Blod, S. 43; Hundsnurscher/Taddey beziehen sich auf ein anderes Datum: Sie schreiben, dass die badische Regierung die Gemeinde bereits am 14. Oktober 1864 als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannte, vgl. Hundsnurscher/Taddey, S. 90.
[66] Als Grund für diesen Vorschlag wurden die unruhigen Zeiten genannt. Vgl. Blod, S. 43.
[67] Vgl. Hundsnurscher/Taddey, S. 90-91.
[68] Clausing, S. 28, zitiert hier Heiko Haumann: Juden in Freiburg i.Br. von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart: Assimilation, Antisemitismus, Suche nach Identität, in: Vorarlberger Landesarchiv (Hg.): Landjudentum im Süddeutschen und Bodenseeraum. Wissenschaftliche Tagung zur Eröffnung des jüdischen Museums Hohenheim, Dornbirn 1992, S. 157.
[69] Entwurf der Statuten einer israelitischen Religionsgemeinde zu Freiburg, StadtAF, C2 Judensachen 75/1 (2), transkribiert bei Blod, S. 85.
[70] Passage aus einem Artikel über die Einweihung der Synagoge in der Freiburger Zeitung vom 25.09.1870, einzusehen unter: Universitätsbibliothek Freiburg, Freiburger historische Bestände digital: https://fz.ub.uni-freiburg.de/show/fz.cgi?cmd=showpic&ausgabe=03&day=25&year=1870&month=09&project=3&anzahl=4 (letzter Aufruf: 26.09.2018).
[71] Vgl. dazu auch Abb. 1 im Anhang.
[72] Vgl. Clausing, S. 42.
[73] StadtAF, C2/75/1.
[74] Vgl. StadtAF, GB47 Nr. 128, Erwerb der Liegenschaft durch die Israelitische Gemeinde 1868/69, S. 166.
[75] Das Grundstück, auf dem die Synagoge errichtet werden sollte ebenso wie das angrenzende Grundstück, auf dem sich später das Gemeindehaus der Israelitischen Gemeinde befand, wurden laut einem Grundbuchauszug 1868 von der Israelitischen Gemeinde käuflich erworben. Hierin heißt es, dass die Liegenschaft „mit dem darauf befindlichen Wohnhaus & Kellergebäude im Flächengehalt von ca. 13.000 Quadratfuß [...] für den Verkaufspreis von 5.000 Gl. [verkauft wird]“. Vgl. StadtAF, B5 IIIa Nr. 100 (alte Nr. 47) Grundbuch 1868-1870, Nr. 128, S. 166.
[76] Vgl. Blod, S. 56.
[77] Vgl. Schreiben des Synagogenraths der israelitischen Gemeinde an die Stadt Freiburg, den Synagogenbau betreffend, vom 26.7.1869, StadtAF, C2/75/1 (Judensachen, Errichtung einer Synagoge).
[78] Vgl. dazu die Aufzeichnung der Stadt „Den Bau der Synagoge betreffend“ in StadtAF, C2/75/1, Errichtung der Synagoge: „Der Vorplatz, welcher sich bei Verlegung der Rempartstraße längs des Bauplatzes zwischen den Grenzen der Rempartkasernen und der des nördlichen Angrenznis ergeben sollte, hat die israelitische Gemeinde zum Eigenthum zu erwerben, wobei die für andere in gleicher Lage geltenden Preise anzunehmen sind.“ In der Antwort des Synagogenrats vom 26. Juli 1869 willigt die Gemeinde ein, „alle an ihrem Eigentum nöthig werdenden Veränderungen als Anlagen von Böschungen, Treppen etc. alleine zu tragen“, behält sich aber noch vor „sich verbindlich [zu] machen [...], das durch fragliche Straßenlage frei werdende Gelände, zu einem vom Gemeinderath noch zu bestimmenden Preise zu übernehmen [...]“ und bittet dabei um ein Entgegenkommen der Stadt. Vgl. StadtAF, C 2 Judensachen 75/1 (4): Errichtung einer Synagoge (1869), vgl. auch Blod, S. 56.
[79] Vgl. Blod, S. 56.
[80] Vgl. Lagerbuch der Gemarkung Freiburg, Vermessungsamt der Stadt Freiburg.
[81] Vgl. Twiehaus, S. 13.
[82] Vgl. Twiehaus, S. 89.
[83] Vgl. Twiehaus, S. 78.
[84] אָרוֹן הָקׄדֶש – der Toraschrein, vgl. Twiehaus, S. 78.
[85] Vgl. dazu Abb. 2 im Anhang.
[86] Vgl. dazu Twiehaus, S. 78 mit einem Bezug zu Hammer-Schenk, Synagogen in Deutschland, S. 195.
[87] Vgl. Clausing, S. 30.
[88] So sind zumindest keine Ausschreitungen oder öffentliche, negative Kritiken überliefert. Vgl. dazu auch Abb. 2.
[89] Vgl. Twiehaus, S. 78.
[90] Badische Landes-Zeitung, Nr. 232, 30.9.1870, S.3, zitiert in Twiehaus, S. 86.
[91] Vgl. Twiehaus, S. 89.
[92] Vgl. Twiehaus, S. 86.
[93] Vgl. Twiehaus, S. 89
[94] Vgl. hier zum Beispiel ein Auszug aus einer Predigt von Adolf Lewin von 1890: „So ist die Fremde uns zur Heimat geworden. So fühlen wir uns nicht als Fremde – werden auch nicht als solche angesehen – denn ein Gefühl der Liebe umschlingt uns alle und unsere andersgläubigen Mitbürger, das Band der Liebe zu Fürst und Vaterland, zu unserer schönen Mutterstadt.“ StadtAF, Dwe 580, zitiert bei Blod, S. 68.
[95] Tatsächlich haben reichsweit ca. 100 000 Juden am Ersten Weltkrieg teilgenommen. Vgl. Clausing, S. 31 und Marc von Lüpke-Schwarz, Juden im Ersten Weltkrieg, Deutsche Welle 2014, abzurufen unter: https://www.dw.com/de/juden-im-ersten-weltkrieg/a-17808361 (letzter Aufruf: 28.02.2019).
[96] Vgl. Clausing, S. 31.
[97] Vgl. hier insbesondere StadtAF, D.Ti Nr. 427; C3/20/3; C4/I/16/10; C4/II/6/8.
[98] Vgl. Clausing, S. 34.
[99] Ebd.
[100] Vgl. StadtAF, D.Ti. Nr. 437, Tiefbauamt Bausachen Betreff: Sammlung von Situationsplänen über Bauvorhaben an der Werderstraße, Schreiben an den Stadtrat vom 16. März 1912.
[101] Vgl. StadtAF, C3/20/3.
[102] Ebd.
[103] Die Verhandlungen um den Neubau sind bis 1913/14 in den Akten nachvollziehbar. Erst Mitte der 1920er Jahre werden die Pläne für den Anbau wieder aufgenommen. Vgl. StadtAF, C3/20/3; D.Ti. Nr.437.
[104] Vgl. StaAF, C4/I/16/10.
[105] Vgl. dazu ebenfalls Clausing, S. 93. Dies wird auch noch einmal aus einer Beratung des Bauausschusses vom 20. und 21. Juli 1924 deutlich, in dessen Aufzeichnungen es heißt:
„[...] gegen den geplanten Erweiterungsbau bestehen erhebliche Bedenken, weil durch denselben im Hinblick auf die in der Nähe befindlichen Monumentalbauten (Theater, Universität) in städtbaulicher Hinsicht eine befriedigende Lösung nicht zu erwarten ist. Bedauerlich ist, dass wenn der Erweiterungsbau zustande kommt, wobei immerhin erhebliche Mittel erforderlich werden, die für späterhin nicht zu umgehende Errichtung einer neuen Synagoge nur in weitere Ferne gerückt wird. Der Stadtrat würde deshalb den Neubau einer Synagoge für zweckmäßig halten und wäre bereit, in diesem Falle der israelitischen Gemeinde durch unentgeltliche [Anm. JW: im Dokument durchgestrichen] Geländeüberlassung in weitgehendstem Masse entgegenzukommen. Der Stadtrat III“, Beratung im Bauausschuss am 20./21. Juli 1924 dazu, StadtAF, C4/I/16/10.
[106] Weiterleitung des Erweiterungsgesuchs des Synagogenrats vom 21. März 1924 an den Stadtrat, kommentiert am 1. April 1924 vom städt. Hochbauamt: Stadtarchiv Freiburg: Akte C4/I/16/10.
[107] Vgl. StadtAF, D.Ti. 437, Situationspläne an das Freiburger Tiefbauamt von 1914 und 1922.
[108] Vgl. dazu Abb. 3 im Anhang.
[109] Vgl. Hammer-Schenk, S. 522.
[110] Vgl. StadtAF, D.Ti. 437, Schreiben des Stadtrats an das Tiefbauamt vom 31 Juli 1924 und Beschluss vom 4. August 1924.
[111] Vgl. StadtAF, C4/I/16/10, Beschluss vom 20. Mai 1925.
[112] Sitzungsprotokoll vom 24. Juli 1930, Bauvorhaben der Sinner’schen Brauereigesellschaft, StadtAF, C4/I/19/03 (Private Bausachen; Baugesuche an der Bertold-Str. 42/44 Werthmannplatz/Löwenbrauerei).
[113] Am 9. Januar 1939 hatte das Liegenschaftsamt in einem Schreiben an den Freiburger Oberbürgermeister nach den neuen Ansprechpersonen für den Verkauf des Areals gefragt und bat darum, diese Frage an den badischen Wirtschaft- und Finanzminister weiterzuleiten. Dabei bat das Amt den OB auch darum, den Wirtschafts- und Finanzminister darauf aufmerksam zu machen, dass „die beiden Grundstücke aus Gründen des öffentlichen Interesses nur an die Stadt verkauft werden dürfen.“ StadtAF, C4/I/16/10, Bausachen Synagoge, vgl. dazu auch Clausing, S. 94.
[114] 22. Januar 1931, Entschließung des Bezirksrats hinsichtlich der Beschwerde der Stadt Freiburg gegen die Genehmigung des Baugesuchs der Löwenbrauerei A.G., StadtAF, C4/I/19/03 Private Bausachen; Baugesuche an der Bertold-Str. 42/44 Werthmannplatz/Löwenbrauerei.
[115] Ausführlich wurden die Vorgänge rund um die Pogromnacht in Freiburg unter anderem beschrieben von Clausing, S. 255-267 und Brucher Lembach, S. 25-73.
[116] Zum Begriff der „Machtergreifung“ auch im Vergleich zum von NS-Größen häufiger benutzen Terminus der „Machtübernahme“ vgl. Norbert Frei: „Machtergreifung“. Zu einem historischen Begriff, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, Jahrgang 31, Heft 1 (1983), S. 138-145, abzurufen über: https://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1983_1.pdf (letzter Aufruf: 3.3.2019).
[117] Vgl. Brucher-Lembach, S. 26-27.
[118] Vgl. Clausing, S. 65.
[119] Vgl. Brucher-Lembach, S. 16.
[120] Vgl. Saul Friedländer: Das Dritte Reich und die Juden, München 2007, S. 40 sowie Brucher-Lembach, S. 34.
[121] Wobei es einige Ausnahmeregelungen gab, die nach dem Ermessen von Kerber einige Lehrkräfte in Freiburg begünstigte, vgl. Clausing, S. 170.
[122] Vgl. Brucher-Lembach, S. 35 sowie Clausing, S. 152.
[123] Vgl. Brucher-Lembach, S. 35.
[124] Hierfür verantwortlich waren mitunter das „Gesetz zur Zulassung als Rechtsanwalt“ vom 7. April 1933 sowie eine Verordnung des Reichsarbeitsministeriums vom 22. April 1933, welche die kassenärztliche Zulassung der Ärzte streng reglementierte. Vgl. Clausing, S. 77.
[125] Die Nürnberger Gesetzte legten auf perfide Weise fest, wer als „Volljude“, „Halbjude“, „Vierteljude“, „Mischling“, „Arier“, „Reichsbürger“ oder nur „Staatsangehöriger des Reiches“ anzusehen war. Dazu mussten alle „Arier“ einen „Ariernachweis“ erbringen, um als „Reichsbürger“ anerkannt zu werden, vgl. dazu auch: Friedländer, S. 166-168.
[126] Vgl. Reichsbürgergesetz vom 15. September 1935, RGBI, Teil I, Nr. 100, S. 1146 abzurufen unter: https://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=0007_nue&object=facsimile&st=&l=de (letzter Aufruf: 29.05.2019).
[127] Vgl. Clausing, S. 117.
[128] Heiko Pollmeier: „Arisierung“, in: Wolfgang Benz, Hermann Graml, Hermann Weiß (Hg.): Enzyklopädie des Nationalsozialismus, 3. korrigierte Auflage, Stuttgart 1998, S. 374-375.
[129] Ebd. S. 374.
[130] Vgl. Flümann, S. 5.
[131] Zum Beispiel bei Brucher-Lembach, S. 10 oder Frank Bajohr: „Arisierung“ in Hamburg: Die Verdrängung der jüdischen Unternehmer, 1933-1945, 2. Auflage, Hamburg 1998, S. 9, Fußnote 1. Claudia Flümann nennt als Alternative den Begriff der „wirtschaftlichen Existenzvernichtung“, der auch die flächendeckende Enteignung und Konfiszierung jüdischer Vermögenswerte einschließe. Vgl. Flümann, S. 6. Eine der frühesten Arbeiten zur Enteignung der jüdischen Bevölkerung durch die Nationalsozialsten hat Avraham Barkai verfasst. Er arbeitet mit dem Begriff der „Entjudung“, der einen stärkeren Bezug zu den später folgenden Säuberungsaktionen bildet. Vgl. Avraham Barkai: Vom Boykott zur „Entjudung“. Der wirtschaftliche Existenzkampf der Juden im Dritten Reich, 1933-1943, Frankfurt a. M. 1988.
[132] Dabei wird der Begriff in der vorliegenden Arbeit stets in Anführungszeichen verwendet, um auf die in ihm angelegten definitorischen Schwierigkeiten hinzuweisen und seine Legitimität in der Geschichtswissenschaft auf diese Weise erneut in Frage zu stellen.
[133] Vgl. Brucher-Lembach, S. 43-44.
[134] Vgl. Pollmeier, S. 374-375.
[135] Eine Einschätzung zur Rolle der Freiburger Stadtverwaltung in der ersten Phase des nationalsozialistischen Regimes im Zusammenhang mit jüdischer Wohnungs- und Eigentumsübernahme nahm Kathrin Clausing vor. Demnach sei jüdischer Besitz sehr schnell zu „städtischer Dispositionsmasse“ geworden. Vgl. Clausing, S. 100.
[136] Vgl. die Situation in Freiburg am Beispiel der Verkaufsverhandlungen der Firma Lippmann ab Ende 1934, ausführlich beschrieben bei Brucher-Lembach, S. 45-48.
[137] Hauptsächliche Ziele der NS-Wirtschaftspolitik bestanden hingegen aus Aufrüstung und Kriegsvorbereitung, wofür eine große Anzahl von neuen Arbeitsplätzen geschaffen werden sollte. Vgl. Hans-Ulrich Thamer: Wirtschaft und Gesellschaft unterm Hakenkreuz, abzurufen unter: https://www.bpb.de/geschichte/nationalsozialismus/dossier-nationalsozialismus/39551/wirtschaft-und-gesellschaft?p=all (letzter Aufruf: 06.03.2019).
[138] Vgl. Brucher-Lembach, S. 60.
[139] Hierzu trugen vor allem bei: „Verordnung über die Anmeldung des Vermögens von Juden“ vom 26. April 1938 sowie die dritte Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 14. Juni 1938, die erstmals definierte, welche Betriebe als „jüdisch“ bezeichnet werden sollten. Vgl. RGBl Band 1938 Teil I, Nr. 63, Seite 414-415 und RGBl Band 1938 Teil I, Nr. 91, S. 627, abzurufen unter: http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?apm=0&aid=dra&datum=19380004&seite=00000414&zoom=2 (letzter Aufruf: 29.05.2019).
[140] Vgl. Clausing, S. 211.
[141] Vgl. Brucher-Lembach, S. 44. Clausing gibt an, dass bis Ende 1937 70% der einst über 200 jüdischen Unternehmen in Freiburg verkauft oder aufgelöst worden waren. Vgl. Clausing, S. 211. Auf Reichsebene nennt Pollmeier für April 1938 eine Zahl von 40% jüdischer Betriebe, die noch nicht arisiert worden waren. Vgl. Pollmeier, S. 375.
[142] Vgl. Brucher-Lembach, S. 53 sowie Clausing, S. 212.
[143] Vgl. Clausing, sie zitiert eine wirtschaftswissenschaftliche Dissertation aus dem Jahr 1941, S. 222.
[144] Vgl. Kapitel 4.2 dieser Dokumentation.
[145] Vgl. Clausing, S. 222-223.
[146] Vgl. Clausing, S. 223.
[147] Vgl. Reichsgesetzblatt vom 28. März 1938: „Gesetz über die Rechtsverhältnisse jüdischer Kultusvereinigungen“, abzurufen unter: http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?apm=0&aid=dra&datum=19380004&seite=00000338&zoom=2 (letzter Aufruf: 29.05.2019).
[148] Ebd., S. 338.
[149] Vgl. Clausing, S. 261 sowie Heiko Wegmann: Die Reichspogromnacht in Freiburg – Eskalation des Antisemitismus, in: Peter Kalchthaler, Robert Neisen, Tilmann von Stockhausen (Hg.): Nationalsozialismus in Freiburg, Begleitbuch zur Ausstellung des Augustinermuseum , Petersberg 2016, S. 222 .
[150] Vgl. Wegmann, S. 222.
[151] Vgl. Clausing, S. 261.
[152] Vgl. Clausing, S. 262.
[153] Vgl. Brucher-Lembach, S. 75.
[154] Vgl. Clausing, S. 262.
[155] Eine der früheren Arbeiten lieferte Dieter Obst: „Reichskristallnacht” – Ursachen und Verlauf des antisemitischen Pogroms vom November 1938, Frankfurt a.M. 1991. Lokale, auf Freiburg bezogene Darstellungen wurden u.a. vom Stadtarchiv Freiburg (Hg.): Das Schicksal der Freiburger Juden am Beispiel des Kaufmanns Max Mayer und die Ereignisse des 9./10. November 1938, mit Beiträgen von Rolf Böhme und Heiko Haumann, Freiburg i.Br. 1989, Brucher-Lembach, S. 74-77 oder Clausing, S. 255-267, erarbeitet.
[156] Vgl. z.B. Clausing, S. 255, Obst, S. 6., Brucher-Lembach, S. 75.
[157] Die in Deutschland lebende, polnische Familie Herszel Grynszpans wurde Ende Oktober 1938 im Rahmen einer konzentrierten Aktion gegen Juden mit polnischer Staatsangehörigkeit in ihr Herkunftsland abgeschoben. Dieser Vorgang gilt als erste Massendeportation in den Osten und wurde weder in Deutschland noch darüber hinaus als besonderes Ereignis wahrgenommen. Vgl. Barkai, S. 146.
[158] So gibt es zum Beispiel Widersprüche hinsichtlich der Beteiligung der SS an den Aktionen. Himmler hatte angeordnet, dass die SS sich nicht an den Aktionen beteiligen sollte. Aus den Aufzeichnungen Goebbels geht indes eine direkte Weisung Hitlers an den „Stoßtrupp Hitler“ – eine Keimzelle der SS – hervor. Vgl. Elke Fröhlich (Hg.): Die Tagebücher von Joseph Goebbels. Sämtliche Fragmente, Teil I, Bd. 6, München 1998, S.180. Auch in Freiburg ist die Beteiligung von SA und SS nicht vollständig aufgeklärt. So geht aus Zeugenaussagen und polizeilichen Berichten hervor, dass die SA nicht beteiligt gewesen ist (vgl. StAF F 176 / 1, 964). Clausing kommt in ihrer Darstellung zu dem Schluss, dass wenige, nicht aus Freiburg stammende SA- und SS-Männer an der Verwüstung und Brandstiftung der Freiburger Synagoge beteiligt gewesen sind, vgl. Clausing, S. 259; die jüngste Darstellung zu diesem Thema, die Wegmann im Rahmen der Ausstellung „Freiburg im Nationalsozialismus“ vorgelegt hat, kommt wiederum zu dem Ergebnis, dass die SA erst bei der Absperrung des Geländes, nicht aber schon bei der Brandstiftung selbst beteiligt gewesen ist. Die Brandstiftung habe demnach die SS zu verantworten gehabt. Vgl. Wegmann, S. 222.
[159] Vgl. Barkai, S. 147.
[160] Auszüge aus Goebbels’ Rede vom Abend des 9.11.1938, zitiert bei Friedländer, S. 293.
[161] Vgl. Friedländer, S. 295.
[162] Ebd.
[163] Vgl. Friedländer, S. 296. Diese Aufgabe haben in Freiburg Gestapo-Mitglieder übernommen, vgl. Wegmann, S. 222.
[164] Vgl. Brucher-Lembach, S. 74.
[165] Vgl. Wegmann , S. 222.
[166] Ebd.
[167] Vgl. Clausing, S. 260.
[168] Vgl. Wegmann, S. 222.
[169] Die Gegenstände befinden sich heute in der Neuen Synagoge Freiburg und wurden in das Gebäude integriert. Die Gegenstände waren nach 1938 von einem Sammler in Besitz genommen worden, der sie später dem Augustinermuseum zur Verfügung stellte. Auskunft von Irina Katz, Vorsitzende der Israelitischen Gemeinde Freiburg vom 20.05.2019.
[170] Dies beruht auf der Einschätzung des Historikers Markus Wolter. Es konnte bislang nicht herausgefunden werden, ob die Aufnahme absichtlich oder irrtümlich falsch datiert wurde. Vgl. dazu die Einschätzung von Markus Wolter: Ein wertvoller historischer Fund, Artikel in der Badischen Zeitung vom 9.11.2018, S. 22 und Abb. 4 im Anhang dieser Dokumentation.
[171] Sein Sohn hatte die Fotografie im Jahr 2018 an das Stadtarchiv Freiburg übergeben. Josef Vollmer war im Jahr 2000 verstorben.
[172] Wolf Middendorff, geboren am 6. Juni 1916 in Bielefeld, lebte ab 1934 mit seiner Familie in Freiburg. Middendorff, der Mitglied des nationalsozialistischen Schülerbundes und später der Hitlerjugend war, trat am 1.1.1935 in die NSDAP ein. Als Jurastudent machte er am 10. oder 11. November 1938 ein Foto der ausgebrannten und schwer beschädigten Freiburger Synagoge. Er wurde später ein renommierter Jurist und Experte für Kriminologie in Freiburg. 1979 veröffentlichte er einen Aufsatz, in dem er die Vorgänge in der Reichspogromnacht in Freiburg historisch verkürzt und seine eigene Rolle aufwertend nachzeichnete. Vgl. Wolf Middendorff: Als die Synagogen brannten, in: Freiburger Almanach 1979, S. 67-73, sowie ein weiterer Aufsatz Middendorffs zum Thema aus dem Jahr 1988: Die „Reichskristallnacht“ in historischer und kriminologischer Sicht, in: Schau-ins-Land 107 (1988), S. 227-245. Er verschwieg darin die eigene Verstrickung in das nationalsozialistische Regime, die nach den Recherchen des Historikers Markus Wolter so weit gingen, dass er nicht nur überzeugtes NSDAP-Mitglied war, sondern er auch eine „antisemitische Abwandlung des Hecker-Liedes“ verfasste, dessen Datum nicht bekannt ist. In einem Brief aus dem Jahr 1946 beschrieb er die Demokratie als „aufgezwungen“ und für Deutschland „wesensfremd“. Vgl. Markus Wolter: Am Synagogenstein. Ein Foto, ein Jurastudent und die Pogromnacht gegen die Juden – Wolf Middendorff und der 10. November 1938 in Freiburg, in: Badische Zeitung, Magazin, vom 26.2.2018, S. III.
[173] Vgl. Wolter: Ein wertvoller historischer Fund, S. 22.
[174] Vgl. Heiko Wegmann: Die Brandnacht vor 75 Jahren. Die SS und das Reichspogrom vom 9. November 1938 in Freiburg, Artikel in der Badischen Zeitung Online vom 9.11.2013, abzurufen unter: https://www.badische-zeitung.de/freiburg/die-brandnacht-vor-75-jahren--76997395.html (letzter Aufruf: 20.08.2019).
[175] Vgl. Käthe Vordtriede: „Es gibt Zeiten, in denen man welkt“. Mein Leben in Deutschland vor und nach 1933, herausgegeben von Detlef Garz, Lengwil 1999, S. 198, auch zitiert bei Clausing, S. 261.
[176] Vgl. Clausing, S. 265.
[177] Ebd.
[178] Vgl. dazu das Vorwort zum Synagogendossier auf der Webseite des Zentralrats der Juden von Salomon Korn, Vizepräsident des Zentralrats der Juden von 2003 bis 2014, online archiviert und abzurufen unter: https://archive.fo/20160220193544/http://www.zentralratdjuden.de/de/topic/385.html (letzter Aufruf: 30.07.2019).
[179] Vgl. Kurt Pätzold: Artikel „Reichskristallnacht“, in: Enzyklopädie des Nationalsozialismus, S. 679.
[180] Ebd. Insgesamt wurden zwischen dem 12. November 1938 und Jahresende 1938 97 Verordnungen erlassen, vgl. Brucher-Lembach, S. 79.
[181] Zentral ist hierbei vor allem die „Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben“ vom 12. November 1938, die sämtliche Geschäftstätigkeiten von Juden fortan untersagte. Juden durften im weiteren Verlauf keinen Einzelhandels- oder Handwerksberufen mehr nachgehen, Tätigkeiten, mit denen sich viele gerade noch über Wasser halten konnten. Vgl. Brucher-Lembach, S. 78.
[182] Dieser Prozentsatz wurde im Oktober 1939 noch einmal um 5% erhöht, da die angestrebte Summe von einer Milliarde Reichsmark vorgeblich nicht erreicht wurde. Vgl. Barkai, S. 151.
[183] Vgl. Brucher-Lembach, S. 78.
[184] Vgl. Clausing, S. 266.
[185] Vgl. Clausing, S. 261.
[186] Vgl. Barkai, S. 150-151.
[187] RGBl vom 3. Dezember 1938, Artikel II, § 6, abzurufen unter: http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?apm=0&aid=dra&datum=19380004&seite=00001709&zoom=2 (letzter Aufruf: 29.05.2019).
[188] Ebd., Artikel II, § 8.
[189] Ebd., Artikel V, § 16.
[190] Erlass des Reichswirtschaftsministeriums vom 1. März 1939, zitiert bei Clausing, S. 267, FN 1139. Wobei ihnen auch diese letzten Habseligkeiten teilweise einfach abgenommen wurden, wie der bei Brucher-Lembach beschriebene Fall der Witwe Josephine Mayer zeigt. Ihr wurden im März 1939 von SS- oder SA-Leuten auch die Eheringe von den Fingern gezogen mit der Notiz, dass sie diese von nun an nicht mehr besitzen dürfe. Vgl. Brucher-Lembach, S. 80.
[191] Die Gegenstände wurden nicht nach ihrem eigentlichen Wert geschätzt, sondern lediglich nach ihrem Gewicht vergolten. 10 % dieses schon sehr geringen Wertes behielt die Stadt Freiburg als „Bearbeitungsgebühr“ ein. Vgl. Clausing, S. 267.
[192] Ebd.
[193] Vgl. Brucher-Lembach, S. 81.
[194] Vgl. Brucher-Lembach, S. 97.
[195] In der Pogromnacht von 9. auf 10.11.1938 wurde eine Vielzahl von Dokumenten der Israelitischen Gemeinde von Gestapo-Mitgliedern entwendet. Vgl. Wegmann, S. 222. Davon zeugen auch Vermerke auf den Scheckheften der Israelitischen Gemeinde Freiburg bei der Deutschen Bank, die nach dem Verlust der alten Scheckhefte neu erstellt werden mussten. Dort steht, teilweise handschriftlich vermerkt: „Scheckheft 840351-500 abhandengekommen beim Brand der Synagoge.“ Vgl. HADB, F33-526. Weitere Dokumente sind durch die Liquidation der Israelitischen Gemeinde bis 1942 sowie die kriegsbedingten Zerstörungen abhanden gekommen. Die Überlieferungen, die noch existieren und für diese Recherche herangezogen werden konnten sind, wie oben bereits erwähnt, die Akten aus der Israelitischen Gemeinde Freiburg im Zentralarchiv zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland (ZJD) ebenso wie der Mirkofilmbestand der Israelitischen Gemeinde Freiburg KdöR. Vgl. dazu auch S. 11-12 dieser Dokumentation.
[196] Im Stadtarchiv Freiburg befindliche Korrespondenzen der Stadtverwaltung u.a. mit dem badischen Finanz- und Wirtschaftsministerium in Karlsruhe geben darüber aus städtischer Perspektive Auskunft. Vgl. StadtAF, C4/1/16/10, C4/II/6/8, C4/VII/3/13, C4/VII/12/5 sowie C4/XII/28/6.
[197] Vgl. Lagerbuch der Gemarkung Freiburg, Vermessungsamt der Stadt Freiburg. Der Grundbucheintrag zur Teilung erfolgte am 16.06.1926.
[198] Vgl. dazu auch Kapitel 2.3 dieser Dokumentation.
[199] Vgl. Schwendemann, Baupolitik, FN 30, dieser Aufsatz wurde erstmals im Band „Freiburg im Nationalsozialismus“ veröffentlicht: Heinrich Schwendemann: Baupolitik im Freiburg der NS-Zeit, in: Peter Kalchthaler, Tilmann von Stockhausen (Hg.): Freiburg im Nationalsozialismus, Freiburg 2018, S. 63-82.
[200] Vgl. Schwendemann, S. 23.
[201] Schwendemann beschreibt Schlippe als einen „ambitionierten Exponenten der konservativ-völkischen Heimatschutzbewegung, die sich schon in der Weimarer Ära gegen modernistische Tendenzen im Städtebau und in der Architektur positioniert hatte.“ Vgl. Schwedemann, ebd.
[202] Vgl. Abb. des Modells bei Schwedenmann, S. 35.
[203] Vgl. Schwendemann, S. 34-35.
[204] Ebd., S. 28.
[205] Vgl. Schreiben von Verkehrsdirektor Denzlinger an OB Kerber vom 18.11.1938, StadtAF, C4/II/06/08 Festhalle, dort: „Errichtung eines Kongreßhauses“.
[206] Ebd. Schreiben von Schlippe an OB Kerber, Betr. Erbauung eines Kongreß- und Tagungshauses auf dem Grundstück der bisherigen Synagoge vom 1.12.1938, StadtAF, C4/II/06/08.
[207] Ebd.
[208] Notiz von Bürgermeister Hofner vom 28.3.1939, StadtAF, C4/II/06/08.
[209] Schreiben von OB Kerber an den Bad. Finanz- und Wirtschaftsminister vom 13.12.1938, Betr. Verordnung über den Einsatz jüdischen Vermögens, Vgl. GLA, Abt. 237 / Zugang 1967-19 / 2106, veröffentlicht auch bei Brucher-Lembach, S. 135-136.
[210] Schreiben des badischen Finanz- und Wirtschaftsministers vom (undatiert, bzw. schlecht leserlich) Dezember 1938, Nr. Jd. 00 047, an den Oberbürgermeister der Stadt Freiburg, GLA, Abt. 237 / Zugang 1967-19 / 2106.
[211] Vgl. Schreiben des Liegenschaftsamt Freiburg an OB Kerber vom 9.1.1939, StadtAF, C4/I/16/10.
[212] Antwort des Badischen Wirtschafts- und Finanzministers an OB Kerber vom 24.1.1939, StadtAF, C4/I/16/10.
[213] So können weder Erpressungs- oder Enteignungsandrohungen von Seiten der städtischen Behörden oder Privatpersonen in Richtung der Israelitischen Gemeinde nachgewiesen werden. Dies war bei der „Arisierung“ von privaten Betrieben, v.a. durch den Einfluss von Oberregierungsrat Stöckinger und/oder durch die Habgier einzelner Kaufinteressenten jedoch durchaus gängige Praxis, wie einzelne Fälle bei Brucher-Lembach dokumentierten. Vgl. z.B. der Verkaufsvorgang, in dem Julius Sutter die Zwangslage von Michael Rosenthal ausnutzte und die Verkaufsbedingungen zu seinen Gunsten nachträglich veränderte. Sutter hatte gedroht, Rosenthal beim Finanzamt zu denunzieren, wenn er den ursprünglich vereinbarten Kaufpreis für seine Firma nicht deutlich senke. Dies hätte die bevorstehende Auswanderung der Familie verzögert oder sogar unmöglich gemacht, weshalb sich Rosenthal auf den niedrigeren Kaufpreis einließ. Vgl. Brucher-Lembach, S. 81 – 82.
[214] Erwin Hiegert wird im Kaufvertrag vom 15.3.1939 als „Rechnungsdirektor“ und Bevollmächtigter der Stadt Freiburg bezeichnet. Von 1922-1953 war er erster Geschäftsführer der gemeinnützigen „Siedlungsgesellschaft“ in Freiburg, heute Freiburger Stadtbau GmbH, vgl. Freiburger Stadtbau GmbH (Hg.): 90 Jahre Freiburger Stadtbau. Eine Dokumentation, Freiburg 2009, abzurufen über: https://www.freiburger-stadtbau.de/fileadmin/pdf/FSB-Doku_90.pdf (letzter Aufruf: 26.05.2019).
[215] Dies geht zumindest aus einem Schreiben des Liegenschaftsamts an den Oberbürgermeister vom 4. April 1939 hervor, in dem es heißt, dass der Vertragsvorschlag von Seiten des Oberrats zugestimmt wurde. StadtAF, C4/VII/12/5, Schreiben vom 4. April 1939.
[216] Vgl. StadtAF, C4/VII/12/5, Kaufvertrag zwischen Israelitischer Gemeinde und der Stadt Freiburg vom 15.3.1939, § 5.
[217] Vgl. Schreiben des Freiburger Liegenschaftsamts vom 27.5.1939 an den OB – Abt. III, StadtAF, C4/VII/12/5; Das Mietrecht wurde bereits ein Jahr später zurückgenommen. Vgl. Schreiben des Liegenschaftsamts Freiburg an die Polizeidirektion Freiburg vom 8.11.1940. Darin heißt es: „[...] Nachdem die Benützung durch die israelitische Gemeinde nicht mehr infrage kommt, das Anwesen aber dringend für die Unterbringung des Heilpädagogischen Hortes in Anspruch genommen werden muss, bitten wir die Polizeidirektion um möglichst rasche Freigabe des Hauses.“ Vgl. ZJD, B1/22, 204.
[218] Vgl. Genehmigung des Badischen Finanz- und Wirtschaftsministers an das Grundbuchamt Freiburg vom 22. Mai 1939, Kopie in RLF. Die Eintragung im Grundbuch erfolgte schließlich am 21.09.1939.
[219] Schreiben des Oberfinanzpräsidenten in Karlsruhe vom 23.6.1939, StadtAF, C4/VII/12/5.
[220] Schreiben des Synagogenrats (Julius Bloch) vom 5.7.1939, StadtAF, C4/VII/12/5.
[221] Schreiben des Liegenschaftsamts an den OB – Abt. III vom 12. Juli 1939, StadtAF, C4/VII/12/5.
[222] Schreiben von Julius Bloch vom 23.8.1939, StadtAF, C4/VII/12/5.
[223] Auf der Rückseite des Schreibens von Julius Bloch vom 23.8.1939 hat das Kassenamt am 1. September 1939 vermerkt: „Wiedervorlage an den Oberbürgermeister Abt. III; Die laut § 4 des Kaufvertrags bei Auszahlung des Kaufpreises zu verrechnenden Kosten für den Abbruch sowie die rückständigen öffentlichen Lasten des Grundstücks sind vor einigen Tagen bereits wieder bei der Stadtkasse einbezahlt worden. Der Synagogenrat hat tatsächlich nur den im gemäss § 4 des Vertrags zustehenden Kaufpreis erhalten. Die Angelegenheit dürfte hiermit erledigt sein. Das Kassenamt.“ Vgl. StadtAF, C4/VII/12/5.
[224] Schreiben des Reichsamts für Kirchenangelegenheiten vom 23.3.1939, Betrifft: Ruinen der Synagogen jüdischer Kultusvereinigungen, StadtAF, C4/VII/12/5.
[225] Aus den Akten geht indes nicht hervor, ob sich dieser Einheitswert auf beide Grundstücke bezieht oder nur auf das, auf dem die Synagoge stand. In der Formulierung im Rahmen des Bescheids über die voraussichtliche Höhe der Grunderwerbssteuer vom 31. März 1939 des Finanzamts Freiburg wird lediglich von „Einheitswert des Grundstücks“, also Singular, gesprochen. Der auf dieser Grundlage angesetzte Kaufpreis von 67.000 RM setzt sich nun entweder aus diesem Einheitswert sowie aus dem anteilig dafür berechneten Wert des Nachbargrundstücks, der dann mit 20.700 RM veranschlagt wurde, oder aus einem Pauschalwert für beide Grundstücke, das seit dem 1.1.1935 eine Wertsteigerung von 20.700 RM erfahren hätte, was unter den allgemeinen Umständen des zunehmenden Werteverfalls für jüdische Grundstücke jedoch als eher unrealistisch einzuschätzen ist. Vgl. StadtAF, C4/VII/12/5, Bescheid des Finanzamts Freiburg vom 31.3.1939, vgl. dazu auch Fritsche, S. 355.
[226] Vgl. StadtAF, C4/XII/28/6, „Anlage eines Parkplatzes auf dem früheren Synagogengelände Ecke Rotteck- und Löwenstrasse“ sowie Baupläne und Akte vom 28. April 1939 in StadtAF, C4/I/16/10. Warum der Parkplatz 1939 dann doch nicht realisiert wurde, geht aus den Akten nicht hervor. In einer schriftlich dokumentierten Beamtenbesprechung vom 11. Juli 1939 heißt es jedoch, dass die „[...] endgültige Entscheidung [...] zurückgestellt werden [muss], bis Klarheit darüber besteht, ob und inwieweit das Gelände für die geplanten Erweiterungsbauten der Universität beansprucht wird.“ StadtAF, C4/XII/28/6.
[227] Vgl. dazu Kapitel 6.2. (S. 100-105) in dieser Darstellung.
[228] Weder bei Brucher-Lembach noch bei Clausing wurde diese Frage thematisiert. Erst im Zuge der jüngsten Diskussionen um die Geschichte des Platzes der Alten Synagoge, die durch die Umgestaltung des Platzes aufkamen, wurde diese Frage, teilweise auch öffentlich, aufgeworfen. Vgl. dazu z.B. den Artikel von Frank Zimmermann in der Badischen Zeitung Online vom 2.6.2018: Unter welchen Umständen wurde 1939 das Synagogengrundstück an die Stadt verkauft?, abzurufen unter: https://www.badische-zeitung.de/unter-welchen-umstaenden-wurde-1939-das-synagogengrundstueck-an-die-stadt-verkauft--153180894.html (letzter Aufruf: 26.05.2019).
[229] Unter „Verwertung“ wird im wirtschaftswissenschaftlichen Sinn die „Veräußerung von Sicherheitsleistungen durch das Kreditinstitut, wenn der Kreditnehmer seinen Rückzahlungsverpflichtungen unter vorheriger Androhung nicht nachkommt“ verstanden. Vgl. Begriff „Verwertung“ bei der Bundeszentrale für politische Bildung, abzurufen unter: http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/lexikon-der-wirtschaft/21052/verwertung (letzter Aufruf: 26.5.2019). In der Geschichtswissenschaft wird der Begriff „Verwertung“ sehr häufig genutzt, um den staatlichen Vermögensraub an den Juden durch das nationalsozialistische Regime zu beschreiben. So schreibt Martin Friedenberger: „Das Reichsfinanzministerium war in die organisatorischen Vorbereitungen der Deportationen einbezogen worden und erhielt nunmehr die Aufgabe, das gesamte Vermögen, das die zur Vernichtung bestimmten Juden in Deutschland zurückließen, der fiskalischen Verwertung zuzuführen.“ Vgl. Friedenberger, S. 21. Dabei ist in den Akten der NS-Behörden sehr oft vom „Vermögensverfall“ die Rede, so wie in der 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 25.11.1941, abgedruckt bei Friedenberger, S. 74-75. Die „Verwertung“, die dem „Vermögensverfall“ folgte, ist ein Begriff der in wissenschaftlichen Arbeiten zum Themenkomplex der „Arisierung“ häufig gebraucht, in der Geschichtswissenschaft bislang aber kaum einer eindeutigen Definition unterzogen wurde.
[230] Vgl. Clausing, S. 312; Brucher-Lembach spricht von 360 Deportierten, vgl. Brucher-Lembach, S. 115.
[231] Vgl. Brucher-Lembach, S. 115.
[232] Vgl. Clausing, S. 312.
[233] Vgl. Clausing, S. 313.
[234] Vgl. Clausing, S. 314.
[235] Vgl. Clausing, S. 316.
[236] Mit ihm starben in Gurs oder weiteren Lagern 138 aus Freiburg deportierte Menschen. Über das Schicksal von 109 weiteren ist nichts bekannt. Wahrscheinlich sind sie ebenfalls ermordet worden oder aufgrund der unzureichenden medizinischen und sonstigen Versorgungslage verstorben. 39 der Deportierten konnten sich mit der Unterstützung von Hilfsorganisationen in sichere Drittländer retten, 11 tauchten in die Illegalität ab. Vgl. Clausing, S. 319.
[237] Vgl. Clausing, S. 319. Die Reichsvereinigung wurde am 4.7.1939 durch die 10. Verordnung zum Reichsbürgergesetz neu gegründet. Davor hatte sie als selbständiger jüdischer Zusammenschluss bestanden. Mit der Verordnung vom 4.7. wurde sie zu einer Zwangsorganisation, die dem Innenministerium, bzw. dem Reichsicherheitshauptamt und somit den lokalen Gestapo-Stellen unterstellt war. In der Verordnung heißt es dazu unter § 5: „(1) Der Reichsminister des Innern kann jüdische Vereine, Organisationen, und Stiftungen auflösen oder ihre Eingliederung in die Reichsvereinigung anordnen. (2) Im Falle der Auflösung gelten für die Liquidation die Vorschriften des bürgerlichen Rechts. Der Reichsminister des Innern kann jedoch Liquidationen bestellen und abberufen und die Art der Liquidation abweichend von den Bestimmungen des bürgerlichen Rechts regeln. Nach Durchführung der Liquidation ist das Vermögen der aufgelösten jüdischen Einrichtungen auf die Reichsvereinigung zu übertragen. (3) Im Falle der Eingliederung fällt das Vermögen der betroffenen jüdischen Einrichtungen an die Reichsvereinigung. Eine Liquidation findet in diesen Fällen nicht statt. Für die Verbindlichkeiten der eingegliederten Einrichtungen haftete die Reichsvereinigung mit ihrem gesamten Vermögen. (...)“ Vgl. FN 898 bei Flümann, S. 256.
[238] Vgl. Beate Meyer: Tödliche Gratwanderung. Die Reichsvereinigung der Juden in Deutschland zwischen Hoffnung, Zwang, Selbstbehauptung und Verstrickung (1939-1945), Göttingen 2011, S. 102-103.
[239] Bei den späteren, ab 1941 einsetzenden Deportationen waren die Betroffenen gezwungen, ihren Besitz systematisch schriftlich in Listen festzuhalten und ihre Besitztümer vor dem Abtransport an Sammelstellen abzugeben. Das Vorgehen im Zuge der Deportation vom 22. Oktober wirkte im Vergleich dazu weitgehend unkoordiniert und aus spontanen Ereignissen heraus umgesetzt. Vgl. Fritsche, Ausgeplündert, S. 473.
[240] Anordnung über die Verwaltung und Verwertung des jüdischen Vermögens in Baden durch Robert Wagner vom 23.10.1940, StAF, F 202/32 6984, abgedruckt auch bei Brucher-Lembach, S. 121.
[241] Diese Praxis wurde durch Berichte von Zeitzeugen belegt, die die Abtretung des Vermögens an die „Reichsvereinigung“ unmittelbar vor den Deportationen bestätigen. Vgl. die Aussage von Notar Holler bei Brucher-Lembach. S. 118.
[242] Vgl. Brucher-Lembach, S. 120.
[243] Vgl. Brucher-Lembach, S. 119-120.
[244] Vgl. Brucher-Lembach, S. 120.
[245] Ebd.
[246] Ebd.
[247] Vgl. Schreiben des Generalbevollmächtigen für das jüdische Vermögen in Baden, Dornes, an die Polizeidirektion Freiburg vom 6. November 1940, vgl. ZJD, B1/22, 204, Blatt 5.
[248] Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei an Regierungspräsidenten beim Reichskommissar für die Saarpfalz und den badischen Minister des Innern: Verfügung vom 9.11.1940: GLA Ka, 237. Nr.40480, Kopie in: StAF, F 202/32 6984, Blatt 101-103, zitiert auch in Fritsche, Ausgeplündert, S. 475.
[249] Vgl. StAF, F 202/32, 6984, Blatt 103.
[250] Vgl. Abschrift Nr. 578 der Anordnung Wagners vom 15.2.1941, StAF, F 202/32, 6984, Blatt 100, vgl. dazu auch: Gerhard J. Teschner: Die Deportation der badischen und saarpfälzischen Juden vom 22. Oktober 1940. Vorgeschichte und Durchführung der Deportation bis zum Kriegsende im Kontext der deutschen und französischen Judenpolitik, Frankfurt/Main 2002, S. 87-88.
[251] Vgl. Fritsche, S. 476-477.
[252] Vgl. StAF, F 202/32, 6984 , Blatt 60.
[253] Runderlass vom 22. Juni 1941, StAF F202/32, 6984, Blatt 150.
[254] Vgl. Runderlass Nr. 68 des Generalbevollmächtigten für das jüdische Vermögen, Dornes vom 11.8.1941, StAF, F202/32, 6984, Blatt 177.
[255] Vgl. Brucher-Lembach, S. 129.
[256] Vgl. StAF, Akte N25/2, 4/3.
[257] Vgl. Brucher-Lembach, S. 132-134.
[258] Vgl. Fritsche, S. 477.
[259] Vgl. Brucher-Lembach, S. 124.
[260] Vgl. Grafik bei Brucher-Lembach, S.127.
[261] Vgl. Brucher-Lembach, S. 127.
[262] Im Vorfeld der späteren Deportationen wurde deshalb eine andere Vorgehensweise gewählt. Mit der elften Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 25.11.1941 verfiel das Vermögen der Deportierten automatisch dem Land Baden, sobald sie die Reichsgrenze überschritten hatten. Dies war für die ausführenden Behörden aber insofern problematisch, da einige Lager innerhalb des Reichsgebiets lagen, was den Vermögensverfall wiederum rechtlich bedenklich machte. Vgl. Brucher-Lembach, S. 132.
[263] Vgl. Fritsche, S. 494.
[264] Vgl. Fritsche, S. 493.
[265] Vgl. Barkai, S. 192-193.
[266] Vgl. Fritsche, S. 493.
[267] Vgl. Fritsche, S. 493.
[268] Vgl. Fritsche, S. 494. Laut dem „Gesetz über die Einziehung volks- und staatsfeindlichen Vermögens“ vom 14.7.1933 konnte sog. Reichsfeinden die Staatsbürgerschaft aberkannt und das Vermögen beschlagnahmt werden. Als „Reichsfeinde“ galten Menschen, die der Politik des NS-Regimes kritisch bis feindlich gegenüberstanden. So waren es vor allem Sozialdemokraten, deren Rechte und Besitz auf diese Weise verloren gingen. Ab 1941 wurde dieses Gesetz auch herangezogen, um den Verfall jüdischer Vermögenswerte an die Reichskasse zu legitimieren. Vgl. RGBI, vom 14. Juli 1933, S. 479, abzurufen unter: http://www.ns-quellen.at/gesetz_anzeigen_detail.php?gesetz_id=35410&action=B_Read (letzter Aufruf: 18.2.2019).
[269] Ende Februar 1942 ging auch die Zuständigkeit über die Verwaltung und „Verwertung” des Grundbesitzes jüdischer Emigranten sowie ab April 1942 auch über das beschlagnahmte Vermögen der emigrierten Juden, das bis dahin zentral durch das Finanzamt Moabit-West in Berlin verwaltet wurde, an die örtlichen Oberfinanzpräsidien über. Vgl. Fritsche, S. 496.
[270] Vgl. Fritsche, S. 494-495.
[271] Vgl. Brucher-Lembach, S. 149.
[272] Es existiert noch ein Kontoblatt, das von der örtlichen Polizeidirektion für die „Synagogen Gemeinde“ angelegt wurde. Dies ist insofern bemerkenswert, als dass diese Kontoblätter sonst nur für Personen geführt wurden. Offensichtlich bestand über das Vorgehen bei der Verwaltung und Verwertung von Gemeindevermögen zu diesem Zeitpunkt noch Unklarheit. Vgl. StAF, N25/2 4/1, Blatt 155.
[273] Vgl. FN 217.
[274] Vgl. ZJD, B1/22, 204, Blatt 3.
[275] Vgl. ZJD, B1/22, 204, Blatt 10.
[276] Vgl. ZJD, B1/22, 204, Blatt 17.
[277] Vgl. Kontoblatt der „Synagogen Gemeinde“, StAF, N25/2 4/1, Blatt 155.
[278] Vgl. Auflistung der Kontodaten der aus Freiburg deportierten Juden per 31. Januar 1942, ZJD, B/122, 134.
[279] Karl Eisemann fungierte spätestens ab Dezember 1940 als zuständige Person der „Reichsvereinigung der Juden“ für Baden in Karlsruhe. Vgl. Anordnung von Dornes vom 19.12.1940 StAF, F 202/32, 6984, Blatt 63. Er überlebte und war nach 1945 als Jurist, später als Vizepräsident des baden-württembergischen Verwaltungsgerichtshofs tätig. Eisemann starb im Jahr 1982. Vgl. Meyer, S. 367.
[280] Schreiben von Karl Eisemann an die Polizeidirektion Freiburg vom 22. Februar 1941, ZJD, B1/22, 204, Blatt 63.
[281] Allerdings wurden nur 529,75 RM an die Gemeinde überwiesen. Aus welchen Abzügen im Einzelnen die 121,25 RM bestanden, lässt sich auf der Grundlage der eingesehenen Akten nicht nachvollziehen. Vgl. Kontoblatt der „Synagogen Gemeinde“, StAF, N25/2 4/1, Blatt 155. Nathan Rosenberger wird in einem Schreiben Eisemanns vom 20.1.1941 darum gebeten in „der Eigenschaft als Vertrauensmann für den Bezirk Freiburg i./Br. und Oberbaden [...] die daselbst noch ansässigen jüdischen Personen zu betreuen. Sie sind auch ermächtigt, mit den Behörden in allen die Abwicklung der jüdischen Organisationen in Ihrem Bezirk betreffenden Angelegenheiten zu verhandeln und Reichsvereinigungsvermögen in Empfang zu nehmen und zu bescheinigen.“ Vgl. StadtAF, C5/ 2470, Blatt 5.
[282] Vgl. Kontoblatt der „Synagogen Gemeinde“, StAF, N25/2 4/1, Blatt 155.
[283] Schreiben von Karl Eisemann an Dornes vom 24.4.1941, ZJD, B1/19 164.
[284] Schreiben von Dornes an Eisemann vom 11.8.1941, ZJD, B1/19 164.
[285] Schreiben von Eisemann an Dornes vom 5.5.1941, ZJD, B1/19 164.
[286] Zitiert bei Brucher-Lembach, S. 144.
[287] Nach Auskunft von Dr. Martin Stingl, Generallandesarchiv in Karlsruhe, vom 19.2.2019.
[288] Vgl. dazu bei Meyer, S. 277-78: „Die betroffenen Juden sowie die Bezirksstellen der Reichsvereinigung hatten ihre „Aussiedlung“ selbst zu finanzieren [...]. Das RSHA befürchtete – zu Recht, wie sich bald herausstellte – dass die Stapostellen bzw. deren Mitarbeiter in den Transporten eine willkommene Gelegenheit sahen, sich mit Barmitteln zu bereichern im sicheren Wissen, dass die Zeugen auf Nimmerwiedersehen „im Osten“ verschwinden würden. Deshalb übte das RSHA über die Reichsvereinigung auf deren Bezirks- und Außenstellen Druck aus, alle Transaktionen über das „Sonderkonto W“ abzurechnen.“
[289] Im Gegensatz zu Freiburg bestehen für die Stadt Mannheim detaillierte Auflistungen des jüdischen Gemeindevermögens, auf das Eisemann, und auch das belegend die Akten, jedoch offenbar erst nach mehrmaligem Nachfragen bei den lokalen Polizeibehörden Zugriff hatte. Vgl. Vermögensaufstellung der Israelitischen Gemeinde Mannheim vom 19.12.1938, ZJD, B1/19 338.
[290] Vgl. Weisung Dornes’ vom 12.12.1940, StAF, F 202/32 6984.
[291] Schreiben Karl Eisemanns an Dornes vom 15.4.1941, ZJD, Bestand 1/19 164.
[292] Fritsche beschreibt die Schwierigkeit von Kontobewegungen für jüdische Bankkunden am Beispiel des jüdischen Unternehmers Paul Reiss in Mannheim, vgl. S. 411. Vgl. dazu auch Meyer, S. 141 und Abschnitt „Beteiligung der Banken“ in dieser Dokumentation.
[293] So versandte die Zentrale der Deutsche Bank kurz nach der Verabschiedung der Nürnberger Gesetze ein Rundschreiben an alle Filialen, in dem sie darum gebeten wurden eine Liste aller „nichtarischer“ Firmen zusammenzustellen, an die Kredite über 200 000 RM vergeben wurden. Vgl. James, S. 195.
[294] So zum Beispiel ein Schreiben der Bezirkssparkasse Staufen i. Brsg. an den zuständigen Landrat in Müllheim. Die Bank gab bereitwillig Auskunft über ihre jüdischen Kunden sowie die auf deren Konten vorhandenen Vermögenswerte. Vgl. StAF, F 202/32 6984, Blatt 54.
[295] Vgl. James, S. 197.
[296] Vgl. Fritsche, S. 175
[297] Vgl. Fritsche, S. 175.
[298] Vgl. Flümann, S. 166.
[299] Vgl. James, S. 196.
[300] Vgl. Fritsche, S. 212.
[301] Für Freiburg sind in 323 eingereichten Verzeichnissen insgesamt 18,14 Millionen Reichsmark vermerkt, vgl. Zusammenstellung über das von den Juden im Land Baden nach der Verordnung vom 26. April 1938 angemeldete Vermögen, nicht datiert, in: GLA Ka, 237, Nr. 40482, zitiert nach Fritsche, S. 214.
[302] Vgl. Fritsche, S. 223.
[303] Vgl. Fritsche, S. 224.
[304] Vgl. Weisung von Carl Dornes vom 7. Dezember 1940, StAF, F 202/32 6984, Blatt 49.
[305] Antwort von Dr. Martin Müller vom 12.12.2018 auf die schriftliche Anfrage der Autorin vom 5.12.2018.
[306] Kontoübersicht „Israelitische Gemeindeverrechnung“ (Kontokorrentkonto), in: Deutsche Bank Filiale Freiburg i. Brsg., Maschinenkontokorrent 1939, von Jacob bis Julia-Werke, Historisches Institut der Deutschen Bank, HADB, F33-526.
[307] Vgl. FN 222.
[308] Vgl. FN 290.
[309] Vgl. Barkai, S. 198.
[310] Ebd.
[311] Zu dieser Schizophrenie vgl. die genanntem Aufgabenbereiche der Mitglieder der Reichsvereinigung bei Meyer, S. 10.
[312] Vgl. Barkai, S. 202. Neben dem Sonderkonto „W“ wurden auch ein Sonderkonto „H“ angelegt, auf das die Beträge der sogenannten „Heimkehrerverträge“ überwiesen wurden. Jene Verträge wurden kurz vor der Deportation älterer Menschen nach Theresienstadt zwischen der „Reichsvereinigung“ und den zur Deportation aufgeforderten Juden geschlossen. Den Betroffenen wurde damit weiß gemacht, dass sie mit den regelmäßigen Zahlungen durch diesen Vertrag eine Art „Altersvorsorge“ für Theresienstadt erkauft hätten. Die Gelder wurden jedoch ebenso wie andere Vermögenswerte in der „Reichsvereinigung“ zur Finanzierung der Deportationen genutzt. Die übrig gebliebenen Gelder dieses Sonderkontos „H“, 107 Millionen RM, wurden kurz vor Kriegsende nach Prag verschoben. Dort entzogen sie sich nach 1945 dem Zugriff der „Nachfolgeorganisationen“. Es bestand jedoch Anspruch der Nachfolgeorganisationen auf ein Restsaldo von 4,5 Millionen DM. Vgl. Ernest H. Weismann, Die Nachfolge-Organisationen, in: Bundesministerium der Finanzen (Hrsg.): Die Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts durch die Bundesrepublik Deutschland, Bd. II, Das Rückerstattungsgesetz, München 1981, S. 777.
[313] Vgl. dazu ausführlich Kapitel „IV. Die Rest-Reichsvereinigung“ bei Meyer, S.347-394.
[314] Hierzu heißt es bei Weismann: „Die N.O. [Nachfolgeorganisationen, Anm. JW] erhoben wegen des „H-Konto“ RE-Sammelansprüche und verfolgten sie bei den RE-Gerichten. Diese Ansprüche wurden vom ORG [Oberstes Rückerstattungsgericht, Anm. JW] Berlin anerkannt. Wegen des früheren Gemeindevermögens riefen sie die „Berliner Kommission“ an, die nach der Kontrolldirektive 50 zur Entscheidung über Gemeinde- und Eigentum von öffentlichen Körperschaften eingesetzt worden war. [...] Die N.O. entdeckten gelegentlich der Überprüfung des Reichsschuldbuches und der Archive eines Berliner Bankhauses, wo das Konto der RVJ [Reichsvereinigung der Juden, Anm. JW] geführt worden war, eine Bilanz, die zugunsten der RVJ Aktiven, bis dahin unbekannt, in Höhe von RM 67 Millionen aufwiesen. Diese für den OFP [Oberfinanzpräsidenten, Anm. JW] Berlin-Brandenburg, als Vermögensverwaltungsstelle der RVJ, im Reichsschuldbuch eingetragenen Schulverschreibungen und verbriefte Verbindlichkeiten des ehemaligen Deutschen Reichs waren mit Mitteln der RVJ erworben worden. Die RVJ hatte sie aus Entziehungen, zum Teil aus dem Vermögen juristischer Personen (Gemeinden) oder nicht rechtsfähiger Vereine (Stiftungen), zum anderen Teil aus dem Vermögen einzelner jüdischer Verfolgter erlangt. In welchem Umfang die Mittel aus Vermögen von Organisationen oder von Individualberechtigten stammten, war schwer festzustellen, ebenso, ob Individualberechtigte oder deren Rechtsnachfolger Ansprüche nach dem BRüG erhoben hatten.“ Vgl. Weismann, S. 777-778.
[315] Vgl. Weismann, S. 778.
[316] Ebd.
[317] Vgl. Gruner, S. 127.
[318] Vgl. Gruner, S. 127.
[319] Vgl. Brucher-Lembach, S. 81.
[320] Vgl. Barkai, S. 196.
[321] „[...] das Vermögen der Reichsvereinigung nunmehr vor allen Dingen der Endlösung der europäischen Judenfrage diene [....] damit Reichsmittel hierfür nicht in Anspruch genommen werden brauchen. Aus diesem Grunde ist es nicht mehr schlechthin als jüdisches, sondern letzthin als ein bereits für Zwecke des deutschen Reiches gebundenes Vermögen zu betrachten [...]. Es würde dementsprechend einen Eingriff in die mir als vom Reichsmarschall Beauftragten für die Endlösung der europäischen Judenfrage zustehenden Befugnisse darstellen, wenn andere Behörden und Dienststellen durch Beschlagnahme usw. die hiesigen Planungen auf diesem Gebiet [...] durchkreuzen würden.“ Zitiert nach Barkai, S. 194, der sich auf ein Zitat im ausführlich wiedergegebenen Memorandum des Referats Mädel im Reichsfinanzministerium, Finanzierung der Maßnahmen zur Lösung der Judenfrage, vom 14.12.1942, BAK, R2 Nr. 12222, S. 226 ff., beruft.
[322] Vgl. Brucher-Lembach, S. 21.
[323] Die Deportationszahlen nach Gurs werden in der Literatur unterschiedlich hoch angegeben. Brucher-Lembach nennt 350 Menschen, die 1940 nach Gurs deportiert wurden. Vgl. Brucher-Lembach, S. 21. In einem Beitrag zur Kirchen- und Religionsgeschichte in Freiburg, u.a. von Gabriele Blod und Peter Fäßler, werden 360 Personen genannt. Vgl. Gabriele Blod, Peter Fäßler, Heiko Haumann, Franz Hundsnurscher, Ernst Schulin: Kirchen und Religionsgemeinschaften in Freiburg, in: Heiko Haumann, Hans Schadek: Geschichte der Stadt Freiburg im Breisgau, Band 3, Von der badischen Herrschaft bis zur Gegenwart, 2. Auflage, Freiburg 2011, S. 485-514, hier S. 510. In der vom Stadtarchiv Freiburg geführten Datenbank „Biographische Datenbank Freiburger Juden“, werden derzeit 379 Personen aufgeführt. Vgl. „Biographische Datenbank Freiburger Juden“, Stadtarchiv Freiburg.
[324] Zu den späten Deportationen von Menschen aus „Misch-Ehen“ oder von „Mischlingen“ vgl. Heiko Haumann, Dagmar Rübsam, Thomas Schnabel, Gerd R. Ueberschär: Hakenkreuz über dem Rathaus. Von der Auflösung der Weimarer Republik bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs (1930-1945), in: Geschichte der Stadt Freiburg, S. 297-371, hier S. 338.
[325] Vgl. Brucher-Lembach, S. 194.
[326] Vgl. Brucher-Lembach, S. 155.
[327] Ebd.
[328] Vgl. Brucher-Lembach, S. 156-157.
[329] Vgl. Protokoll der konstituierenden Sitzung der neuen Israelitischen Gemeinde Freiburg vom 24.12.1945. ZJD, Bestand B1/22, 102.
[330] Als „displaced persons“ wurden Menschen bezeichnet, die aufgrund der Kriegseinwirkungen unterschiedlichster Art heimatlos geworden waren und nun an Orten Zuflucht suchten, an denen sie fremd waren. Dies führte in der unmittelbaren Nachkriegszeit oftmals zu Konflikten mit der „einheimischen“ Bevölkerung. So sind auch für die Israelitische Gemeinde Korrespondenzen von Nathan Rosenberger überliefert, in welchen er sich über die neuen Freiburger Gemeindemitglieder beklagt, da sie das Judentum nicht wirklich praktizieren würden. So heißt es in einem Schreiben an L.D. Maier vom 30.8.1948: „Sie hatten damals etwa 1400 Personen in der Gemeinde, und zwar Juden. Heute muss ich leider die Feststellung machen, dass bei den 120 Personen, die in der Landesgemeinde sind, leider nur sehr wenig bewusste Juden sind. Es wird Ihnen ja bekannt sein, dass ich manche Leute erst auf ihr Judentum besinnen, wenn es sich um Vorteile handelt. Daran ist aber nichts zu ändern. – Es ist ja schließlich nicht unsere Aufgabe, die Menschen zu bekehren, sondern die wenigen, die wirklich unseren Satzungen treu geblieben sind, zu betreuen und für sie zu sorgen.“ Brief Nathan Rosenbergs vom 30.8.1948 im Mikrofilmbestand der Israelitischen Gemeinde Freiburg, Rolle 2, Kapitel 5) „Schriftwechsel G-M, 1945-1948, Korrespondenz mit amerikanischen, französischen, israelischen und deutschen Organisationen im Zusammenhang mit den DP`s und Flüchtlingen, Todeserklärungen, Verfolgungsbeschreibungen, Anfragen.“
[331] Vgl. Brucher-Lembach, S. 157.
[332] Vgl. Brucher-Lembach, S. 158.
[333] Vgl. Brucher-Lembach, S. 161.
[334] Constantin Goschler: Wiedergutmachung. Ein Grundbegriff des deutschen Politikdiskurses von der Nachkriegszeit bis heute, in: Alfons Kenkmann / Christoph Spieker / Bernd Walter (Hg.): Wiedergutmachung als Auftrag. Begleitband zur gleichnamigen Ausstellung – Geschichtsort Villa ten Hompel, Essen 2007, S. 81-82.
[335] Vgl. dazu die Wiedergutmachungsrealität aus Sicht der jüdischen Verfolgten. Marlene Klatt bilanziert, dass die Wiedergutmachung für die jüdischen Verfolgten „zwiespältige Erfahrungen“ bedeutete. Negativ wog demnach vor allem, dass die Verfolgten sich teilweise direkt mit ihren „Ariseuren“ auseinandersetzen mussten sowie mit einer hoch bürokratisierten Entschädigungspraxis, die den Betroffenen viel Energie und einen langen Atem abverlangte. Vgl. Marlene Klatt: Die Wiedergutmachungsrealität aus Sicht der jüdischen Verfolgten. Ein Beitrag zum Klima der Wiedergutmachung in der frühen Bundesrepublik, in: Geschichtsort Villa ten Hompel, Alfons Kenkmann (Hg.): Wiedergutmachung als Auftrag. Begleitband zur gleichnamigen Ausstellung, Essen 2007, S. 155. Vgl. dazu auch die zurückhaltende Rolle der Bundesregierung bis 1954, die laut Goschler kein Konzept für die Wiedergutmachung besessen habe, in: Constantin Goschler: Wiedergutmachung. Westdeutschland und die Verfolgten des Nationalsozialismus. S. 311.
[336] Vgl. Brucher-Lembach, S. 182.
[337] Vgl. Brucher-Lembach, S. 182 sowie Christian Pross: Wiedergutmachung.
[338] Vgl. Bertold Unfried: Vergangenes Unrecht. Entschädigung und Restitution in einer globalen Perspektive, Göttingen 2014, S. 39.
[339] Zur Begriffsdebatte und dem Mangel an Alternativen vgl. Goschler, Schuld und Schulden, S. 11-16.
[340] Vgl. Goschler: Schuld und Schulden, S. 16.
[341] Vgl. Brucher-Lembach, S. 153.
[342] Vgl. Goschler, Wiedergutmachung. Westdeutschland und die Verfolgten, S. 83.
[343] Vgl. Unfried, S. 40-41.
[344] Vgl. Brucher-Lembach, S. 174.
[345] Vgl. Brucher-Lembach, S. 183.
[346] Vgl. Brucher-Lembach, S. 169.
[347] Vgl. Jürgen Lillteicher: Westdeutschland und die Restitution jüdischen Eigentums in Europa, in: Constantin Goschler, Philipp Ther (Hg.): Raub und Restitution. „Arisierung“ und Rückerstattung des jüdischen Eigentums in Europa, Frankfurt/Main 2003, S. 95.
[348] Vgl. Lillteicher, S. 95.
[349] Vgl. Goschler, Schuld und Schulden, S. 108, Fußnote 24.
[350] Daran wurde vor allen Dingen kritisiert, dass die Verfolgten auf diese Weise indirekt selbst für ihre Entschädigung aufkommen sollten, da der Staat mit diesem Entschädigungsfonds auf Gelder zugreifen konnte, die eigentlich den Familien der Verfolgten zugestanden hätten, und er (der Staat) damit weniger eigene Mittel für die Entschädigung aufbringen musste. Vgl. dazu Brucher-Lembach, S. 171.
[351] Vgl. Brucher-Lembach, S. 171
[352] Zitat von Walter Schwarz, zitiert nach Brucher-Lembach, S. 171.
[353] Vgl. Lillteicher, S. 95.
[354] Ebd.
[355] Ebd.
[356] Vgl. Brucher-Lembach, S. 153.
[357] Vgl. Brucher-Lembach, S. 183.
[358] Vgl. Brucher-Lembach, S. 187.
[359] Vgl. Goschler, Schuld und Schulden, S. 181.
[360] Vgl. Goschler, Schuld und Schulden, S. 182.
[361] Vgl. Fritsche, Ausgeplündert, S. 737-738.
[362] Vgl. Fritsche, Ausgeplündert, S. 739.
[363] Vgl. Goschler, Schuld und Schulden, S. 201.
[364] Vgl. Goschler, Schuld und Schulden, S. 203.
[365] Vgl. Brucher-Lembach, S. 173.
[366] Vgl. Brucher-Lembach, S. 174.
[367] Vgl. Goschler, Schuld und Schulden, S. 203.
[368] Vgl. Brucher-Lembach, S. 182.
[369] Schreiben von Nathan Rosenberger an das Committee Central Konstanz vom 29.10.1948, ZJD, B 1/22, 198.
[370] Zum Beispiel in einem Brief an Franz Keller vom 7. Mai 1947, Mikrofilmbestand der Israelitischen Gemeinde Freiburg, Film Nummer 2, Kapitel 5) Schriftwechsel G-M, 1945-1948.
[371] Vgl. Brucher-Lembach, S. 174.
[372] Ebd.
[373] Ebd.
[374] Vgl. dazu die teilweise äußerst selbstgerechte Haltung der ehemaligen „Ariseure“ in den Restitutionsverfahren in Freiburg, Brucher-Lembach, S. 178-179.
[375] Vgl. Brucher-Lembach, S. 180.
[376] Ebd.
[377] Ebd.
[378] Schreiben Dr. Julius Ellenbogens an Dr. Meinhold Nussbaum vom 2.2.1949, ZJD, B1/22, 191.
[379] Dies belegt auch eine Bekanntmachung im Badischen Gesetz- und Verordnungsblatt vom 19. Februar 1949, Nummer 6, S. 51: „Die Badische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 16. Januar 1949 beschlossen, der Israelitischen Landesgemeinde für Baden in Freiburg i. Br. gemäß Art. 34 Abs. 2 der Badischen Verfassung die Rechte einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zu verleihen.“
[380] Vgl. Schreiben vom 2. Februar 1949, ZJD, B1/22, 191. Im Jahr 1953 änderte sich dieser Status: Wie aus einem Protokoll einer Gemeinderatssitzung vom 4. Oktober 1953 hervorgeht, wurde die Israelitische Landesgemeinde Südbandes mit Wirkung zum 1. April 1953 mit der Israelitischen Religionsgemeinschaft Nordbadens zusammengelegt. Entstanden ist damit die Israelitische Religionsgemeinschaft Badens mit Hauptsitz in Karlsruhe. Damit waren die rechtlichen Verhältnisse und Zuständigkeiten von vor 1933 wiederhergestellt. Die Gemeinde Freiburg wurde damit wieder zu einer reinen örtlichen Kultusgemeinde, ebenfalls wie 1933. Vgl. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 4. Oktober 1953, ZJD, B1/22, 102.
[381] Vgl. Constantin Goschler: Zwei Wellen der Restitution. Die Rückgabe des jüdischen Eigentums nach 1945 und 1990, in: Haus der Geschichte Baden-Württembergs (Hg.): „Unrecht gut gedeiht nicht“. „Arisierung“ und Versuche der Wiedergutmachung, S. 109.
[382] Schreiben Nathan Rosenbergers an Herrn Nussbaum vom 4.3.1949, ZJD, B 1/22, 191.
[383] Schreiben eines unbekannten Absenders (vermutlich Badisches Finanzministerium) an Nathan Rosenberger vom 28. März 1946, ZJD, B1/22, 69.
[384] Vgl. Schreiben von Eisemann an Rosenberger vom 20.1.1941, StadtAF, C5/2470.
[385] Die IRSO hatte ihren Sitz in New York und war für die Verwaltung und Verteilung des erbenlosen jüdischen Vermögens an jüdische Organisationen in der amerikanischen Besatzungszone sowie im amerikanischen Sektor Berlins zuständig.
[386] Dies geht aus dem Protokoll der Gemeindeversammlung der Israelitischen Gemeinde in Freiburg vom 4. Oktober 1953 hervor. Darin heißt es: „Alle Restitutionsprozesse wegen des geraubten Vermögens der südbadischen Gemeinden sind durchgeführt worden. Auf dieses Vermögen macht jetzt die Nachfolgeorganisation für die französische Zone, die BRANCHE FRANCAISE de la Jewish Trust Corporation for Germany Ansprüche geltend.“ ZJD, B1/22, 102.
[387] Schreiben des badischen Wirtschafts- und Finanzministeriums vom 27. September 1945, ZJD, B1/22, 69.
[388] Schreiben des Badischen Finanzministeriums an Nathan Rosenberger vom 8. März 1946. ZJD, B1/22, 69.
[389] Ebd.
[390] In einem Schreiben Rosenbergers an das badische Finanzministerium vom 14. März 1946 heißt es: „Die Vermögen bestehen aus dem Bankguthaben, Stiftungen, Vereinsvermögen, Grundstücken des Oberrates selbst und den Gemeinden seines Bezirkes, die schätzungsweise einen Wert von über zwei Millionen betragen.“ ZJD, B1/22, 69.
[391] Dies geht zum einen aus einer Niederschrift des Ministeriums vom 28. März 1946 hervor sowie aus einem Schreiben des Ministeriums an Rosenberger, in dem die Landeshauptkasse in Freiburg um einen „weiteren Vorschuß von 50.000 RM“ angewiesen wurde. Vgl. bei in: ZJD, B1/22, 69.
[392] Schreiben von Nathan Rosenberger an das Badische Finanzministerium vom 18.11.1947, ZJD, B1/22, 69.
[393] Schreiben des Finanzministeriums an Nathan Rosenberger vom 23.11.1949, ZJD, B1/22, 69.
[394] Alle in StAF F166/3 965.
[395] StadtAF, C5/4355.
[396] StAF, F166/3 965.
[397] StAF, F166/3 965.
[398] Ebd.
[399] Ebd.
[400] Diese Zahl, die auch in den städtischen Akten auftaucht, ist insofern bemerkenswert, als dass die Abbruchkosten für die Synagogenreste über 5.602 RM, für die die Israelitische Gemeinde 1939 aufkommen musste, an keiner Stelle erwähnt werden. Nach städtischer Einschätzung wurde der damals vom Kaufpreis abgezogene Betrag entweder als legitim angesehen oder sollte an anderer Stelle separat verhandelt werden. Bereits im September 1945, einige Monate vor der Gründung der neuen Israelitischen Gemeinde, wurde Nathan Rosenberger bei der Stadt Freiburg vorstellig und forderte neben der Einrichtung von Büroräumen auch Entschädigung für diese damals veranschlagte Summe für den Abbruch der Synagoge. Weitere Dokumente zu diesem Vorgang sind nicht überliefert. Vgl. Vermerk der Stadt Freiburg vom 10.09.1945, StadtAF, C5/2470.
[401] Dies galt freilich nicht nur für die Gemeinde in Freiburg. Für die Stadt Köln sind ganz ähnliche Überlegungen und Bedürfnisse seitens der jüdischen Gemeinde überliefert. In Köln war die Wiederherstellung des jüdischen Friedhofs eines der ersten und wichtigsten Ziele der Gemeindearbeit nach ihrer Neugründung im Jahr 1945. Hier lassen sich einige Parallelen zu den Vorgängen in Freiburg erkennen. Vgl. Matthias Langrock: Eine Frage der Existenz. Die Synagogengemeinde und die Entschädigung für Kölner Juden, in: Norbert Frei, José Brunner, Constantin Goschler (Hg.): Die Praxis der Wiedergutmachung. Geschichte, Erfahrung und Wirkung in Deutschland und Israel, Göttingen 2009, S. 136.
[402] Vgl. Schreiben Nathan Rosenbergers an das Ministerium des Innern Freiburg vom 6.4.1946, StadtAF, C5/4355.
[403] Vgl. Kleine Notiz in der Zeitung „Das Volk“ vom 23.11.1946, Nr. 42, in: StadtAF, C5/4355.
[404] Einem Schreiben Karl Eisemanns an Nathan Rosenberger vom 22. August 1945 nach, in dem er Rosenberger einige Hinweise übermittelt, was bei der Neugründung einer jüdischen Gemeinde zu beachten wäre, bat Eisemann ihn insbesondere darum, auf die „Wiederinstandsetzung der Friedhöfe ein Augenmerk zu widmen [...]“. Vgl. StadtAF, C5/2470.
[405] Vgl. Schreiben des Oberrats der Israelitischen Landesgemeinde für Südbaden, Nathan Rosenberger, an die Stadt Freiburg vom 11.08.1948. Darin heißt es: „Anlässlich der Besprechung, die der Unterzeichnete am 24. Juli d. Js. mit Herrn Vielhauer hatte, wurde der Stadtverwaltung, vorbehaltlich der Genehmigung durch den Oberrat, vorgeschlagen, in der Frage der Rückgabe der Grundstücke der Israelitischen Gemeinde in der Werderstraße 1 und 3 einen Vergleich dahingehend abzuschließen, dass die Israelitischen Gemeinde der Stadtverwaltung diese Grundstücke belässt und auf ihre Rückgabe verzichtet, wogegen sich die Stadt Freiburg verpflichten würde, vor dem jüdischen Friedhof ein Wärterhaus mit angegliederter kl. Leichenhalle und Waschraum zu erstellen. [...]“ , StadtAF, C5/4355.
[406] Die Pläne und der detaillierte Kostenvoranschlag, der sich in dieser Ausführung auf 50.000 DM beläuft, sind vollständig im Stadtarchiv Freiburg erhalten. Vgl. Kostenvoranschlag und Ausführungspläne vom 17. September 1948, StadtAF, C5/4355.
[407] Schreiben des Liegenschaftsamts an das Bürgermeisteramt, Abt. 1, vom 18. September 1948, C5/4355.
[408] Vgl. Schreiben des Liegenschaftsamts vom 14. Oktober 1948 an das Bürgermeisteramt – Abt. 1, StadtAF, C5/4355.
[409] Schreiben des Freiburger Liegenschaftsamts an das Bürgermeisteramt – Abt. I vom 14.10.1948, StadtAF, C5/4355.
[410] Vgl. Abrechnungsnachweis vom 12.5.1952, StadtAF, C5/4355.
[411] Wer die Liste erstellt hat, ist dem Dokument nicht zu entnehmen. StAF, F200 / 7 524.
[412] StAF, F200 / 7 524.
[413] Vgl. das Schreiben des Grundbuchamts Freiburg vom 19. Mai 1949 an das Finanzamt Freiburg. Darin heißt es bzgl. der beiden Grundstücke auf dem Werthmannplatz: „[...] ist am 18. Mai 1949 der eingetragene Sperrvermerk vom 28. November 1948 gelöscht worden.“ Vgl. StAF, F 200 / 7 524.
[414] Vgl. Öffentliche Urkunde über Tauschvertrag zwischen Badischem Landesfiskus, Universität Freiburg – Stiftungsvermögen – und Stadt Freiburg 4 H 667 / 50, Jahr 1940, Registratur des Liegenschaftsamts Freiburg (RLF).
[415] Vgl. Schreiben Nathan Rosenbergers an die Stadt Freiburg vom 31.3.1950, StadtAF, C5/4355.
[416] Vgl. Schreiben Nathan Rosenbergers an die Stadt Freiburg vom 5.5.1950, StadtAF, C5/4355.
[417] Vgl. Interner Vermerkt der Stadt Freiburg vom 18.9.1950, StadtAF, C5/4355.
[418] So zum Beispiel in einem Schreiben Rosenbergers an Berthold Burger in Tel Aviv vom 18.3.1948, ZJD, B1/22, 198.
[419] Vgl. Schreiben Nathan Rosenbergers an K.D. Mayer vom 9.12.1948, Mikrofilmbestand der Israelitischen Gemeinde, Rolle 2, Kap.5)
[420] Dies belegt die Unterredung zwischen Rosenberger und Wohleb. Wohleb resümiert einige Monate nach dem persönlichen Aufeinandertreffen die wichtigsten Punkte aus diesem Treffen und verweist auf die Aussage Rosenbergers, dass hinsichtlich der Zerstörung der Synagoge und des daneben liegenden Betsaals bis jetzt keine Wiedergutmachung erfolgt sei und Gottesdienste nicht in entsprechend würdigem Rahmen abgehalten werden konnten. Vgl. Abschrift des Briefs von Wohleb an Rosenberger vom 4.1.1953, ZJD, B1/22, 101.
[421] Ebd.
[422] Anonymer Brief an Rosenberger, undatiert, ZJD, B1/22, 101.
[423] Vgl. Arnd Bauerkämper: Das umstrittene Gedächtnis, S. 304.
[424] Dies geht aus dem Protokoll der Gemeindeversammlung vom 4. Oktober 1953 hervor. ZJD, B1/22, 102.
[425] Schreiben Nathan Rosenbergers an das städtische Wohnungsamt Freiburg vom 14.8.1952, ZJD, B1/22, 101.
[426] Ebd.
[427] Damit bot Rosenberger seine eigene Wohnung, die sich in der Hans-Jakobstr. 8 befand, zum Tausch gegen die Nutzung der Räumlichkeiten in der Holbeinstraße an. ZJD, B1/22, 101.
[428] In diesem Schreiben nannte Nathan Rosenberger auch die von ihm als Oberrat der Israelitischen Religionsgemeinschaft Südbadens eingeforderten Gesamtwerte im Rahmen der „Wiedergutmachung. Nach den Berechnungen der Gemeinde beliefen sich diese Werte insgesamt auf 1,8 Millionen DM sowie um ein Objekt, das durch Kriegsschäden zerstört wurde (vermutlich das ehemalige Gemeindehaus in Freiburg) mit 49.500,- DM. Schreiben Nathan Rosenbergers an das baden-württembergische Kultusministerium vom 21. Oktober 1952, ZJD, B1/22, 101.
[429] Schreiben Nathan Rosenbergers an das baden-württembergische Kultusministerium vom 21. Oktober 1952, ZJD, B1/22, 101.
[430] Schreiben von Ernst Guggenheimer an Nathan Rosenberger vom 21. November 1952, ZJD, B1/22, 101.
[431] Ebd.
[432] Vgl. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 4. Oktober 1953. Darin heißt es: „Die Gemeinde hat vor einem Jahr das Haus Holbeinstrasse 25 erworben, um darin Beträume und die Verwaltung, sowie die Wohnung für Herrn Rosenberger unterzubringen. Herr Rosenberger hat leider nur wenige Monate in der Dienstwohnung verleben können. Die Bet- und Verwaltungsräume konnten noch nicht in dem Gemeindehaus untergebracht werden.“ ZJD, B1/22, 102.
[433] Vgl. Brucher-Lembach, S. 194.
[434] Ebd.
[435] Vgl. Brucher-Lembach, S. 194.
[436] Eine Ausnahme bilden wie dargestellt die Aufzeichnungen und Korrespondenzen Nathan Rosenbergers, mitunter über den schleppenden Verlauf bei der Errichtung der Wärterhauses am jüdischen Friedhof, zum Beispiel vom 30.3.1950. StadtAF, C5/4355.
[437] Vgl. Brucher-Lembach, S. 181-183 (Restitution) sowie S. 210-213 (Entschädigung).
[438] Vgl. Brucher-Lembach, S. 182.
[439] Vgl. „Gütliche Vereinbarung“ vom 26.11.1948, StAF, F166/3 965.
[440] Vgl. Fritsche, ausgeplündert, S. 663.
[441] Vgl. Fritsche, Ausgeplündert, S. 663, u.a. Fußnote 465.
[442] Vgl. dazu ausführlich: Arnd Bauerkämper: Das umstrittene Gedächtnis, S. 192-193.
[443] Interner Vermerk vom 19. September 1953, Ehemaliges Synagogengelände, StadtAF, C5/2471.
[444] Vgl. „Gütliche Vereinbarung“ vom 26.11.1948, StAF, F166/3 965.
[445] Hierzu und zum Folgenden siehe denTauschvertrag vom 15. September 1950, beglaubigte Abschrift in der Registratur des Liegenschaftsamts der Stadt Freiburg (RLF), Einsicht mit Genehmigung des Auftraggebers am 13.2.2019 erfolgt; ferner Grundbucheintrag vom 07.04.1951..
[446] Ebd., § 5, S. 7.
[447] Ebd., S. 8.
[448] Vgl. handschriftliche Notiz aus dem Liegenschaftsamt zur Chronologie der Besitzverhältnisse am Werthmannplatz, ohne Datum, RLF. Später wurden 5 qm als Flurstück 475/3 abgetrennt; vgl. Grundbucheintrag 31.10.1961.
[449] Sämtliche Akten über den Bauverlauf, vgl. StAF, G 816/1 367-396.
[450] Grundstücksvereinigungsantrag vom 11. September 1962, adressiert an das Freiburger Grundbuchamt, RLF.
[451] Öffentliche Urkunde über Kauf-Tauschvertrag zwischen der Stadt Freiburg und dem Land Baden-Württemberg, vertreten durch die Oberfinanzdirektion Freiburg vom 7. Januar 1963, RLF.
[452] Öffentliche Urkunde über Vereinbarung zwischen Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg und dem Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Finanzministerium, dieses vertreten durch die Oberfinanzdirektion Freiburg vom 24. April 1964, RLF.
[453] Ebd., S. 3.
[454] Ebd.
[455] Eintrag im Grundbuchamt vom 3. Februar 1967, RLF.
[456] Öffentliche Urkunde über den Kaufvertrag zwischen der Stadt Freiburg und dem Land Baden-Württemberg vom 24. Oktober 1978, RLF.
[457] Ebd., S. 2.
[458] Ebd., S. 3.
[459] Vgl. dazu Lageplan im Anhang des Kaufvertrags vom 24.10.1978, RLF.
[460] Ebd., S. 3.
[461] Vermerk OB vom 2. Juni 1945, in: StadtAF, C5 / 2471.
[462] Vgl. Stadtarchiv Freiburg i. Brsg.: K1/44 Schriftlicher Nachlass von Prof. Dr. h.c. Joseph Schlippe (1885 – 1970), Vorwort und Arbeitsbericht, S.1-2, abzurufen unter: https://www.freiburg.de/pb/site/Freiburg/get/369386/Stadtarchiv_K1_44_Schlippe.pdf (letzter Aufruf: 07.04.2019).
[463] Ebd.
[464] Vermerk des Vorstands der städt. Hochbauamts, Joseph Schlippe, vom 12. Juli 1945, in: StadtAF, C5/2471.
[465] Ebd.
[466] Vgl. Leserbrief in der Badischen Zeitung vom 14. November 2016, „Uns Buben dienten die Trümmer als Spielterrain“, abzurufen über: https://www.badische-zeitung.de/leserbriefe-freiburg/uns-buben-dienten-die-truemmer-als-spielterrain--129789229.html (letzter Aufruf: 07.04.2019).
[467] Schreiben des Liegenschaftsamts an das Bürgermeisteramt Abt. 1 vom 18. September 1948, StadtAF, C5/4355.
[468] Schreiben der Württembergischen Metallwarenfabrik Geislingen (WMF), Niederlassung Freiburg an die Israelitische Landesgemeinde Südbaden vom 16.11.1948, ZJD, B1/22, 194.
[469] Ebd.
[470] Vgl. Abschrift eines Schreibens des Einzelhandelsverbands Südbaden e.V. an die WMF vom 15.11.1948, ZJD, B1/22, 194.
[471] Schreiben der Spar- und Kreditbank Ihringen an das Badische Landesamt für kontrolliertes Vermögen vom 14. Februar 1948, ZJD, B1/22, 192.
[472] Vgl. Extra-Ausgabe der Online-Tageszeitung goodnews4.de: 80 Jahre Vernichtung der Synagoge November 1938. Baden-Baden Synagogen-Diskussion 2018, 10. November 2018, S. 76.
[473] Kaufvertrag für das Grundstück in der Stephanienstraße 5, Baden-Baden zwischen der Israelitischen Religionsgemeinschaft Baden und der Firma Ernst Kölblin, Hofbuchdruckerei, vom 31.März 1955, abgedruckt in: goodnews4 Extra, § 4, S. 95.
[474] Vgl. goodnews4 Extra, S. 3-4.
[475] Vgl. Kap. 5.4, S. 92-95 dieser Dokumentation.
[476] Vgl. Michael Habres: Die Wiederherstellung der ehemaligen Synagoge in Fellheim, in: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege (Hg.): Denkmalpflege Informationen, Nr. 163, März 2016, S. 24, abzurufen unter: http://www.blfd.bayern.de/medien/denkmalpflege_informationen_163.pdf (letzter Aufruf: 13.04.2019).
[477] Ebd., S. 25.
[478] Vgl. Internetauftritt der ehemaligen Synagoge Fellheim: http://ehemaligesynagogefellheim.de/geschichte-des-hauses-und-umgebung/ (letzter Aufruf: 13.04.2019).
[479] Vgl. Schreiben vom 9.6.1961 an die Stadt Freiburg, Amt für öffentliche Ordnung, StAF, G 816/1 378.
[480] Gertrud Luckner (1900 – 1995) unterstützte als Mitarbeiterin der Caritas Jüdinnen und Juden während des NS-Regimes in Freiburg und nutzte u.a. ihre internationalen Kontakte, um Jüdinnen und Juden aus Freiburg die Auswanderung zu ermöglichen. Auch nach 1945 setzte sie sich mit großem Engagement für die ehemals Verfolgten des NS-Regimes ein und rief zur Erinnerung an die Opfer des Holocaust auf. Gleichzeitig forderte sie eine intensivere Auseinandersetzung mit den NS-Gräueltaten. 1979 wurde sie von der Stadt Freiburg zur Ehrenbürgerin ernannt. Vgl. Clausing, S. 305-312.
[481] In einem Brief an den OB von Freiburg schreibt sie am 7.9.1953: „ Der ehemalige Synagogenplatz, den die aus den verschiedenen Ländern zu Besuch kommenden jüdischen ehemaligen Mitbürger – sehr oft als ersten Gang vom Bahnhof – aufsuchen, bietet für diese einen sehr enttäuschenden Anblick. Es ist mir nun überdies bekanntgeworden, dass die Stadt Freiburg diesen Platz ohne auch nur einen bescheidenen Rasenfleck und eine Gedenktafel an die Synagoge, die hier stand, und ebenso an unsere toten jüdischen Mitbürger belassen hat. Die Besucher freuen sich über die vorbildlichen Gartenanlagen unserer Stadt, bedauern aber, dass eben dieser Platz dazu im Kontrast steht. [...] Gertrud Luckner“ StadtAF, C5/2471.
[482] Brief von Fanny Nathanson, StadtAF, C5/2471.
[483] Schreiben des Oberbürgermeisters an Frau Fanny Nathanson vom 2. November 1953, StadtAF, C5/2471.
[484] Interner Vermerk vom 19. September 1953, Ehemaliges Synagogengelände, StadtAF, C5/2471.
[485] StadtAF, C5/2471.
[486] Vgl. Notiz von Stadtrat Murmann an Oberbürgermeister Joseph Brandel vom 14. Juli 1959, StadtAF, C5/2471.
[487] Vgl. Schreiben des Akademischen Rektorats der Universität Freiburg an Oberbürgermeister Joseph Brandel vom 13. November 1959, StAF, G816/1 371.
[488] Vgl. Schreiben von Schwester Elsbeth Wagner aus dem Jahr 1964, StadtAF, C5/2471.
[489] Vgl. Vermerk und Beschluss vom 17.11.1966, App 736, Gedenkplatte zur Erinnerung an die Synagoge, StadtAF, C5/2471.
[490] Vgl. Scherb, Ute: Wir bekommen die Denkmäler, die wir verdienen. Freiburger Monumente im 19. und 20. Jahrhundert, Freiburg i. Brsg. 2005, S. 206, Fußnote 68. Weitere Informationen zu diesen Tafeln sind jedoch weder durch städtische Akten noch Verweise in der Literatur vorhanden. Die beiden Tafeln wurden im Rahmen der großflächigen Umbaumaßnahmen zwischen 2015 und 2017 abgeräumt. Die weitere Verwendung der Tafeln ist bislang noch ungewiss.
[491] Vgl. Adressbucheintrag aus dem Jahr 1940 am Beispiel des Caritasverbandes, der bis 1939 seine Adresse am Werthmannplatz hatte, ab 1940 dann in der Werderstraße 4. Vgl. Amtliches Einwohnerbuch der Stadt Freiburg 1949, Universitätsbibliothek Freiburg, Freiburger historische Bestände – digital, S. 24, abzurufen unter: http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/adr1940/0106 (letzter Aufruf: 29.5.2019).
[492] Vgl. Peter Kalchthaler, Joachim Röderer: „Durchfahrt verboten“, Artikel in der Online-Ausgabe der Badischen Zeitung vom 25. August 2012, abzurufen unter: https://www.badische-zeitung.de/freiburg/durchfahrt-verboten--63308709.html (letzter Aufruf: 14.04.2019).
[493] Ebd.
[494] Vgl. Scherb, S. 241.
[495] Vgl. Artikel von Fabian Vögtle in der Online-Ausgabe der Badischen Zeitung vom 19.02.2018: Das Gurs-Schild soll zurück auf den Platz der Alten Synagoge – jedoch an einen anderen Ort, abzurufen unter: https://www.badische-zeitung.de/das-gurs-schild-soll-zurueck-auf-den-platz-der-alten-synagoge-jedoch-an-einen-anderen-ort (letzter Aufruf: 14.04.2019).
[496] Vgl. Internetaufritt der Israelitischen Gemeinde Freiburg KdöR, Kapitel „Geschichte der Gemeinde“, abzurufen unter: http://www.jg-fr.de/geschichte.html (letzter Aufruf: 14.04.2019).
[497] Vgl. Auskunft des Bürgermeisteramts an eine Einzelanfrage nach § 24 Abs. 4 GemO zu Sachthemen außerhalb von Sitzungen – Grundstück Platz der Alten Synagoge / Dauerausstellung Nähe Gedenkbrunnen vom 15.12.2017, RLF.
[498] Vgl. Artikel über die jüdische Gemeinde Freiburg auf der Seite der Alemannia Judaica, Arbeitsgemeinschaft für die Erforschung der Geschichte der Juden im süddeutschen und angrenzenden Raum, abzurufen unter: http://www.alemannia-judaica.de/freiburg_synagoge_n.htm (letzter Aufruf: 14.04.2019).
[499] Ebd.
[500] Aleida Assmann: Geschichte im Gedächtnis. Von der individuellen Erfahrung bis zur öffentlichen Inszenierung, München 2007, S. 133.
[501] Vgl. Vereinbarung über die Gestaltung und Nutzung des Platzes der Alten Synagoge zwischen der Stadt Freiburg i. Br., der Universität Freiburg und dem Land Baden-Württemberg vom 28.10.2012, Deckblatt, RLF.
[502] Ebd.
[503] Schriftliche Vereinbarung zwischen der Stadt Freiburg und der Universität Freiburg vom 28.10.2012, RLF.
[504] Vgl. Dokumentation des Dialogverfahrens zwischen Israelitischer Gemeinde Freiburg, der Liberalen jüdischen Gemeinde Freiburg – Egalitäre Jüdische Chawurah Gescher e.V. sowie der Stadtverwaltung Freiburg, vgl. dazu Anlage 2 zur Gemeinderatsdrucksache G-18/100: Ergebnisse und Empfehlungen zum Umgang mit den Fundamentresten auf dem Platz der Alten Synagoge, abzurufen unter: https://ris.freiburg.de/show_anlagen.php?_typ_432=vorl&_doc_n1=20180604152249.pdf&_vorl_nr=3770503100101&_nid_nr=&_nk_nr=377 (letzter Aufruf: 30.07.2019).
[505] Ebd.
[506] Vgl. Kapitel „Ausgangslage“ in der Dokumentation des Dialogverfahrens, G-18/100, S. 3, RLF.
[507] Vgl. Artikel „Jetzt entsteht Freiburgs neue Mitte: Platz der Alten Synagoge wird zur Baustelle“ von Simone Höhle, vom 19.04.2016, abzurufen unter: https://www.badische-zeitung.de/jetzt-entsteht-freiburgs-neue-mitte-platz-der-alten-synagoge-wird-zur-baustelle--120909094.html (letzter Aufruf: 29.05.2019).
[508] Vgl. Dokumentation des Dialogverfahrens, Kap. 3.1 Qualität der geborgenen Fundamentsteine, S. 4, RLF.
[509] Ebd.
[510] Vgl. dazu z.B. Beitrag im Deutschlandfunk vom 29.12.2016: „Freiburger Synagogen Streit. Neuer Zoff um alte Mauerreste“ von Thomas Wagner, abzurufen unter: https://www.deutschlandfunk.de/freiburger-synagogen-streit-neuer-zoff-um-alte-mauerreste.886.de.html?dram:article_id=374878 (letzter Aufruf: 29.05.2019); Interview der Universität Freiburg mit Dr. Heinrich Schwendemann vom 03.08.2017, abzurufen unter: http://www.pr.uni-freiburg.de/pm/online-magazin/erleben-und-mitmachen/die-wuerde-des-ortes-wahren; (letzter Aufruf: 29.05.2019);
[511] Einem Artikel der Stadt Freiburg sind die unterschiedlichen Forderungen bzw. Wünsche an den Umgang mit den Fundamentresten zu entnehmen: „Platz der Alten Synagoge. Erinnern und Gedenken an den Vernichtungswahn“, abzurufen unter: https://www.freiburg.de/pb/1029943.html (letzter Aufruf: 29.05.2019). Die Israelitische Gemeinde forderte dabei, die Fundamentreste im Boden zu erhalten und eine Erinnerungsstätte vor Ort zu errichten. Die Stadt Freiburg hat sich hingegen für den Weg entschieden, die Steine teilweise abzutragen, einzulagern und später ohne Denkmaleigenschaft auszustellen. Noch im Boden befindliche Reste wurden mit einer Schutzhülle überzogen und damit versiegelt. Das Mauerwerk für den Gedenkbrunnen konnte damit errichtet werden. Das Vorgehen wurde in einem im Frühjahr 2018 von der Stadt Freiburg einberufenen Dialogverfahren aufgearbeitet. Im Rahmen des Verfahrens sprachen sich die teilnehmenden jüdischen Gemeinden (Israelitische Gemeinde Freiburg und Egalitäre Jüdische Chawurah Gescher e.V.) für die Errichtung eines NS-Dokumentationszentrums bis 2020 aus, in dem die abgetragenen Fundamentsteine als Denkmal/Mahnmal ausgestellt und konserviert werden können. Vgl. dazu Anlage 2 zur Gemeinderatsdrucksache G-18/100: Ergebnisse und Empfehlungen zum Umgang mit den Fundamentresten auf dem Platz der Alten Synagoge, abzurufen unter: https://ris.freiburg.de/show_anlagen.php?_typ_432=vorl&_doc_n1=20180604152249.pdf&_vorl_nr=3770503100101&_nid_nr=&_nk_nr=377 (letzter Aufruf: 30.07.2019).
[512] Vgl. dazu Abb. 5 im Anhang.
[513] Vgl. Artikel aus WELT Online: „Bierflaschen kühlen, wo die Synagoge brannte“ von Philip Kuhn vom 10.08.2017, abzurufen über: https://www.welt.de/politik/deutschland/article167568694/Bierflaschen-kuehlen-wo-die-Synagoge-brannte.html (letzter Aufruf: 20.05.2019).
[514] U.a. sollte ein adäquater Umgang und Einsatz der aufgefundenen und eingelagerten Fundamentreste besprochen werden. Außerdem wurden Maßnahmen diskutiert, auf welche Weise die Bedeutung des historischen Ortes für die Öffentlichkeit sichtbarer gemacht werden kann. Vgl. Dokumentation des Dialogverfahrens, RLF.
[515] Ebd., S. 6.
[516] Ebd., S. 8-9.
[517] Ebd., S. 6-8.
[518] Vgl. Drucksache G-19/081: Platz der Alten Synagoge: Ergänzende Maßnahmen zum Erinnerungsbrunnen, abzurufen unter: https://ris.freiburg.de/show_anlagen.php?_typ_432=vorl&_sid=ni_2019-GR-187&_topst=1&_vorl_nr=4061802100081&_doc_n1=20190327120900.pdf (letzter Aufruf: 30.07.2019).
[519] Ein zunächst diskutierter Vorschlag mit der Aufschrift „Denn mein Haus wird ein Haus des Gebetes für alle Völker genannt werden (Jesaja 56,7) in mehreren Sprachen wurde in einer Abstimmung im Rahmen des Dialogverfahrens (Dialoggespräch Nr. 16 vom 19.03.2019) von der Israelitischen Gemeinde abgelehnt. Vgl. Drucksache G-19/081: Platz der Alten Synagoge: Ergänzende Maßnahmen zum Erinnerungsbrunnen, abzurufen unter: https://ris.freiburg.de/show_anlagen.php?_typ_432=vorl&_sid=ni_2019-GR-187&_topst=1&_vorl_nr=4061802100081&_doc_n1=20190327120900.pdf (letzter Aufruf: 30.07.2019). Im weiteren Verlauf einigten sich die beteiligten Akteure schließlich auf die Aufschrift „Zachor“ – Erinnere dich“ in acht Sprachen. Vgl. Artikel in der Badischen Zeitung vom 25. Juli 2019: Fabian Vögtle: Stadt Freiburg und zwei jüdische Gemeinden einigen sich über die Gestaltung des Synagogenbrunnens, Artikel in der Online-Ausgabe des Badischen Zeitung vom 25.07.2019, abzurufen unter: https://www.badische-zeitung.de/kompromiss-zur-brunnengestaltung--175699155.html (letzter Aufruf: 25.08.2019).
[520] Vgl. Vertragstext in der „Gütlichen Vereinbarung“ vom 26.11.1948, StAF, F166/3 965.
[521] Vgl. Blod, Fäßler, Haumann, Hundsnurscher, Schulin: Kirchen und Religionsgemeinschaften, S. 510.
[522] Der Begriff „Planschbecken“ wurde als Reaktion auf das Baden und Planschen von Menschen im Gedenkbrunnen immer wieder – auch öffentlich – verwendet, um damit auf den u.a. aus Sicht der Israelitischen Gemeinde nicht adäquaten Umgang mit dem Ort, auf dem die Synagoge stand, aufmerksam zu machen. Vgl. Artikel „Polonaise im Pool. Freiburgs epischer Fehltritt in Sachen Gedenkkultur“, in: Zeitschrift FREIeBÜRGER. Unabhängige Straßenzeitung für Freiburg und das Umland zur Unterstützung von Menschen in sozialen Notlagen, Oktober 2017, S. 14-15. Im Frühjahr 2019 konzentrierte sich die öffentlich wahrnehmbare Diskussion um den Gedenkbrunnen auf dem Platz der Alten Synagoge auf die Kosten, die für eine „Nachbesserung“ am Brunnen zugunsten eines sichtbaren Erinnerungsortes veranschlagt wurden. Vgl. Artikel in der Badischen Zeitung vom 9.5.2019: „Stadt bessert bei Brunnen nach“ von Simone Höhl, abzurufen über: https://www.badische-zeitung.de/freiburg/stadt-bessert-bei-brunnen-nach--172871622.html (letzter Aufruf: 29.05.2019).